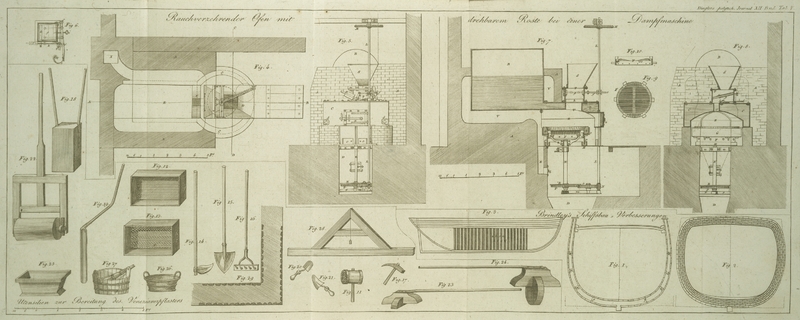| Titel: | Ueber einen Rauch verzehrenden Ofen mit drehbarem Roste bei einer Dampfmaschine an den Bädern du quai de Gêvres. |
| Fundstelle: | Band 12, Jahrgang 1823, Nr. XXXVI., S. 163 |
| Download: | XML |
XXXVI.
Ueber einen Rauch verzehrenden Ofen mit drehbarem
Roste bei einer Dampfmaschine an den Bädern du quai de
Gêvres.
Aus dem Bulletin de la Societe d'Encouragement Nro.
215. S. 164.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Ueber einen Rauch verzehrenden Ofen etc.
Oefen, welche ihren eigenen Rauch verzehren, und die
Nachbarschaft der Gießereien, Brauhaͤuser und groͤßerer
Feuer-Werkstaͤtte von dieser Plage befreien, sind seit mehr dann einem
Jahrhunderte ein Gegenstand der Bemuͤhungen der Pyrotechniker gewesen. Schon
in den ersten Baͤnden der Mémoires de
l'Academie des sciences findet sich die Beschreibung eines Rauch
verzehrenden Ofens, den Hr. Dalesme errichtete, und der
seinem Zweke
vollkommen entsprach. Der Herd war unter einem umgekehrten Heber angebracht, dessen
einer Arm, der als Schornstein diente, laͤnger war: sobald dieser Arm in
seinem Inneren erhizt wurde, erzeugte sich durch die in den kuͤrzeren Arm
einstroͤmende Luft ein Luftzug, der die Flamme auf den Herd zuruͤk und
unter dem Roste hinabtrieb, und dadurch Verbrennung des Rauches bewirkte.
Die zur vollkommenen und bequemen Verbrennung des Rauches noͤthigen
Bedingungen sind: eine solche Lage des Herdes, daß durch das Schuͤrloch
steter Luftzug nach dem Schornsteine Statt hat; 2. Zustroͤmung einer
Luftmasse auf das Feuerungs-Materiale, welche mit diesem in gehoͤrigem
Verhaͤltnisse istHr. Clément fand durch Erfahrung, daß man in der Praxis dreimal so
viel Luft auf das Feuerungs-Materials austroͤmen lassen muß, wenn der
Rauch vollkommen verbrannt werden soll, als die Theorie fodert. A. d. O.; 3. eine Erhoͤhung der Temperatur bei der Beruͤhrung der Luft
oder des Feuerungs-Materiales, welche zur Zersezung der Luft hinreichtDie Argand'schen Lampen zeigen eine eben so sinnreiche als nuͤzliche
Anwendung dieses Grundsazes. A. d. O..
Im J. 1802 haben die HHrn. Clément und Desormes diese Grundsaͤze auf die Oefen ihrer
Eisen-Vitriol- und Alaun-Fabriken zu Paris und Verberie im Dpt. de l'Aisne angewendet. Einige Jahre
spaͤter ließ Hr. Champy, der Sohn, in seiner
Schießpulver-Fabrike zu Essone, Rauch verzehrende Oefen zur kuͤnstlichen
Abtroknung des Schießpulvers errichten. Im J. 1808 wandte Hr. Gengembre bei dem Ofen der in der Muͤnze angebrachten Dampfmaschine
ein sehr sinnreiches Mittel zum Verbrennen des Rauches an, uͤber welches Hr.
Prony am 16. Jaͤner 1809 vor der I. Classe des
Institutes einen sehr vortheilhaften Bericht erstattete.
Als im J. 1814 der Inhaber der Baͤder unter dem Pont-Royal von dem Comité de salut publique eingeladen wurde, den
Bau seiner Oefen zu aͤndern, deren Rauch die Nachbarschaft
belaͤstigte, ließ Hr. Darcet
ruͤkwaͤrts am Ofen in der Hoͤhe des Herdes eine horizontale
Oeffnung durchbrechen, um dem Rauche die noͤthige frische Luft zu seiner Verbrennung zu verschaffen;
er ließ zugleich den Schornstein erhoͤhen, um dem Rauche mehr Zug zu geben,
und diese Abaͤnderungen hatten den beßten Erfolg.
Zu gleicher Zeit ließen die HHrn. Gebruͤder Blanc
zu Lyon nach dem Risse und den Grundsaͤzen des Hrn. Darcet einen Rauch verzehrenden Ofen bei ihrer Potasche Fabrik erbauen,
auf welcher sie Weinstein brannten. Dieser Ofen, der die Nachbarschaft beruhigte,
ist in dem Bulletin de la Société N. 130.
XIV. Jahrg., S. 87 beschrieben.
In den neuesten Zeiten haben mehrere Branntweinbrennereien und Zuker-Raffinerien zu
Paris, wie die Fabrikanten der thierischen Kohle, diese Rauch verzehrenden Apparate
angewendet.
Auch in England bedient man sich derselben seit mehreren Jahren mit dem beßten
Erfolge. Im J. 1801, kurz vor den Versuchen der HH. Desormes und Clement, hat Hr. Roberton zu Glasgow sich auf einen bei einer
Dampfmaschine angebrachten Rauch verzehrenden Ofen ein Patent ertheilen lassen. Sein
Verfahren bestand darin, daß er unmittelbar auf den Herd eine Schichte
aͤußerer Luft auffallen ließ, deren Maͤchtigkeit man mittelst eines
hoͤchst einfachen Mechanismus, welcher in der Stellung zweier schiefen
eisernen Platten bestand, die man von einander entfernen oder einander
naͤhern konnte, und zwischen welchen diese Luftschichte durchzog, reguliren
konnte. Der Zwischenraum zwischen diesen beiden Platten stand mit der
atmosphaͤrischen Luft durch eine horizontale Spalte in Verbindung, die oben
an der Thuͤre angebracht war, und an welche diese Platten stießen.
Auch der beruͤhmte Watt beschaͤftigte sich
lang vor Roberton mit dem Verbrennen des Rauches bei den
Dampf-Maschinen. Seine Vorrichtung hatte viele Aehnlichkeit mit jener des Hrn. Roberton, nur daß die Luft unten durch den Rost herauf
kam, statt von Oben herab. Die erste ist also mit gerader, die zweite mit verkehrter
Flamme.
In dem Verhaͤltnisse als die Dampfmaschinen in England sich
vervielfaͤltigten, ward der Rauch derselben immer laͤstiger, und es
ward durch Parliaments-Acte, bei den vielen eingelaufenen Klagen, den Inhabern dieser
Maschinen befohlen, sich der bekannten Mittel zur Vermeidung des Rauches zu
bedienen. Allein alle bisher angewendeten Mittel kamen auf Kosten des
Feuerungs-Materiales, weil die kalte Luft, die man auf oder zwischen das Feuer und
den Kessel einstroͤmen ließ, waͤhrend sie allerdings den Rauch
verzehrte, eine bedeutende Verminderung der Hize erzeugte. Um diesem Mangel
abzuhelfen, hat man an den verschiedenen Rauch verzehrenden Vorrichtungen
verschiedene Verbesserungen angebracht: wir begnuͤgen uns hier, jener der
HHrn. Thompson, Spencer, Murray, Dikson, Stein, Wakefield
zu erwaͤhnen, die ist den englischen Journalen bekannt gemacht wurdenAlle hieher gehoͤrige Verbesserungen, haben wir aus den neuesten
englischen Journalen in diesem Journale mitgetheilt. Man vergl.
hieruͤber Band VIII. S. 27. Bd. X. S. 411. Bd. XI. S. 267. D..
Unter allen diesen Verbesserungen waren vorzuͤglich zwei, die den Beifall der
geschiktesten Fabrikanten erhielten. Die erste, jene des Hrn. Parker, des Sohnes, zu Warwick, laͤßt die Luft zwischen das Feuer
und jenen Ort eindringen, wo der Rauch in den Schornstein eintritt: dadurch wird die
Verbrennung des Rauches, wenn das Schuͤrloch genau verschlossen ist,
vollendet, und die Raschheit des Zuges der heißen Luft vermindert, die um den Kessel
zieht, ehe sie in den Schornstein eintritt. Der Zutritt der aͤußeren Luft
wird durch eine Klappe geregelt. Wenn man das Feuer des Morgens gehoͤrig
angeschuͤrt hat, wirft man auf den Rost, der von gewoͤhnlicher
Groͤße und etwas schief ist, soviel Kohle als fuͤr den ganzen Tag
noͤthig ist. Wenn das Schuͤrloch und die im Schornsteine angebrachte
Klappe geschlossen sind, so hat der Heizer nichts mehr zu thun; er sieht bloß, ob
der Dampf sich vermindert, und ruͤhrt dann das Feuer, um jene Kohlen zu
verbrennen, die noch nicht verbrannt sind: und dieß ist fuͤr den ganzen Tag
genug.
Die zweite Verbesserung, mit welcher wir uns vorzuͤglich beschaͤftigen,
ist jene des Hrn. Brunton zu Birmingham, der am 29. Jun.
1819 sich hierauf ein Patent ertheilen ließ. Der Ofen dieses geschikten Mechanikers,
der bereits in einer Menge englischer Fabriken eingefuͤhrt ist, wurde
neuerlich durch Hrn. Caillat, Inhaber der Baͤder
quai de gêvres, auch nach Frankreich
gebracht, und befindet sich dort an einer Dampf-Maschine von 6 Pferden, die nicht
bloß diese Baͤder, sondern auch jene des Erloͤsers, (Saint Sauveur, rue St. Denis) mit Wasser versieht.
Dieser auf Tab. V. dargestellte Ofen ist eine Art Athanor, oder ein Ofen mit einem Rumpfe. Er unterscheidet
sich von allen anderen dadurch, daß er mittelst eines sehr hellen Feuers die
moͤglich staͤrkste Wirkung erzwekt. Sein vorderer Theil Z, Fig. 7 und 8, besteht aus einem sehr
gedruͤkten Gewoͤlbe, und ist aus feuerfesten Ziegeln gebaut. Die
Flamme laͤuft in VV um den großen Kessel
B, dessen Form nichts Besonderes besizt. Ein
halbkreisfoͤrmiger Sieder C, der mit B einen Koͤrper bildet, ist vor dem Ofen und
uͤber dem Roste angebracht: er ist der unmittelbaren Wirkung der Flamme
ausgesezt, und in der Mitte desselben laͤuft ein Canal U durch, durch welchen das Feuerungs-Materials auf den Rost faͤllt:
zwei Haͤhne dd lassen das Wasser aus dem
Kessel ablaufen.
Die Aschengrube D, die unter dem Roste angebracht ist,
hat die Form eines Rumpfes; die Asche, welche laͤngs den Waͤnden
desselben hinabgleitet, faͤllt auf eine im Grunde desselben befindliche
Fallthuͤre, welche man oͤffnet, wenn man die Asche ausleeren will.
Hinter dem Roste befindet sich ein Canal, E, mit schiefen
Waͤnden, welcher die Schlaken und jene Asche aufnimmt, die uͤber den
Rand des Rostes gerathen sind. Man nimmt sie durch die Thuͤre b heraus.
Der Rost F ist kreisfoͤrmig und steht mit der
Groͤße des Kessels im Verhaͤltnisse; die Stangen, die ein Zoll weit
von einander entfernt sind, sind in der Mitte verduͤnnt, wie Fig. 9 zeigt. Er ist mit
einem Mantel, gg, von hoͤchst feuerfesten
Ziegeln umgeben, welcher die Kohlen zuruͤkhaͤlt und mit einem eisernen
Umschlage, oo, umfangen, der denselben
haͤlt.
Unter dem Roste befindet sich eine Rinne, HH, von
Gußeisen, die mit sehr trokenem Sande ausgefuͤllt ist, und in welcher der
innere Rand pp sich dreht. Durch diese Vorrichtung
soll der Luft im
Aschenherde der Zutritt in den Ofen nur noch durch den Rost moͤglich
werden.
Das ganze Sistem wird von einem Kreuze getragen, welches aus vier eisernen Armen
besteht, I, die von einem verticalen Stamme, K, gestuͤzt werden, der sich auf einem Zapfen in
einem Zapfenloche, rr, dreht, und durch einen
eisernen Buͤgel, n, noch mehr Festigkeit
erhaͤlt.
Der Mechanismus, welcher dem Roste seine drehende Bewegung ertheilt, besteht aus
einer verticalen Achse L, auf deren oberem Ende das
Triebrad M angebracht ist, welches von einem an einer
horizontalen Achse befestigten Triebstoke, der mit der Welle der Dampfmaschine
mittelst einer Trommel verbunden ist, in Bewegung gesezt wird. Wir haben diesen
Theil des Mechanismus hier nicht gezeichnet, weil er ohnedieß bekannt ist.
Die verticale Achse L traͤgt an ihrem unteren Ende
einen Drilling N, der in ein Zahnrad, O, eingreift, welcher das Rad P treibt, wodurch die Achse K und der Rost
gedreht wird. Eine Eisenplatte R, die uͤber
diesem Rade angebracht ist, hindert die Asche und die Schlaken vor dem Einfallen
zwischen die Zaͤhne des Rades O, dessen Gang
dadurch also nicht gestoͤrt wird.
Die Kohle wird in einen eisernen Rumpf, S, der
uͤber dem Ofen angebracht ist, eingeschuͤttet, und faͤllt aus
demselben in bestimmten Zwischenraͤumen in den Behaͤlter T, und hierauf, durch den Canal U, auf den Rost. Die Menge des auf einmal aus dem Rumpfe fallenden
Feuerungs-Materiales wird durch einen schiefgeneigten Schieber g regulirt, der durch denselben Mechanismus, welcher den
Rost dreht, zugleich hin und her bewegt wird, und zwar auf folgende Weise.
Ein mittelst einer Schraube in die verticale Achse (Siehe Fig. 6) eingelassener
Daͤumling, e, schlaͤgt bei jeder ganzen
Umdrehung auf den Arm eines Hebels f, der an seinem
hinteren Ende sich um den Punct f dreht. Dieser Hebel,
welcher mit dem Schieber a durch zwei eiserne
Baͤnder in Verbindung steht, schließt und oͤffnet diesen Schieber nach
Belieben, und laͤßt die in dem Rumpfe enthaltenen Kohlen durchfallen. Ein
Gegengewicht, l, welches an dem laͤngeren Arme
eines Winkelhebels, k, angebracht ist, der sich um den
festen Punct k dreht, fuͤhrt den Hebel f in seine vorige Lage zuruͤk, und schließt den
Schieber. Die groͤßere oder kleinere Oeffnung, die dieser Schieber lassen soll,
wird durch einen Regulator, q, bestimmt, der an der
rechten Seite des Behaͤlters T angebracht ist,
und aus einem Stuͤke Eisenblech besteht, welches Einschnitte von
verschiedener Tiefe fuͤhrt, und worauf sich der Hebel f stuͤzt: hiedurch entsteht nun ein mehr oder minder weiter
Durchgang. Ein anderer Schieber, h, im Grunde des
Behaͤlters T, der von Aussen durch die Stange i geregelt wird, unterbricht die Verbindung zwischen dem
Rumpfe und dem Roste, wenn man lezteren reinigen will, was durch Oeffnung der beiden
kleinen Thuͤrchen, cc, geschieht.
Die Thuͤre des Ofens a ist innenwendig mit Ziegeln
ausgefuͤttert, damit keine Hize verloren geht.
Die Zapfen des Drillinges N und des Rades O drehen sich in Zapfenloͤchern, welche in dem
Stuͤke Gußeisen m angebracht sind, das in einer
der Mauern des Aschenherdes gehoͤrig befestigt ist; ein anderes
Querstuͤk Eisen, r, welches in die Mauern des
Aschenherdes eingelassen ist, nimmt das Ende des Baumes k auf.
Man sieht aus dem Durchschnitte in Fig. 7, daß die Kohle
stets in dem engsten Theile des Ofens auf den Rost faͤllt, und da nur wenige
Kohlen auf einmal herausfallen, und der Rost sich immer dreht, wird das
Feuerungs-Materials sehr schnell getroknet, und der Rauch, der sich daraus
entwikelt, ehe er in den Schornstein X, Fig. 4, gelangt,
gezwungen, uͤber ein Flammenfeuer hinzuziehen, durch welches er beinahe ganz
verzehrt wird. Die Menge der zur Verbrennung noͤthigen Luft, welche durch das
Aschenloch eingefuͤhrt wird, haͤngt von der Menge der angewendeten
Kohle ab, und da es hier nicht, wie bei den gewoͤhnlichen Oefen,
noͤthig ist, die Thuͤre zu oͤffnen, um das Feuer
anzuschuͤren, wird der Kessel nicht durch das Einstroͤmen von neuer
Luft unaufhoͤrlich abgekuͤhlt. Da der Rumpf Kohlen fuͤr
2–3 Stunden enthaͤlt, so hat der Heizer wenig Arbeit. Es haͤngt
also weder der Aufwand an Kohlen, noch die Dauer des Kessels, auf welche die
Regelmaͤßigkeit des Feuers so vielen Einfluß hat, von der Laune des Arbeiters
ab, und beide lassen sich mit eben jener numerischen Genauigkeit, wie die
Geschwindigkeit der Maschine und die Fuͤllung des Kessels, bestimmen.
Dieser Ofen erspart 25–30 p. C. Kohle, und laͤßt sich an jeder Dampfmaschine
anbringen, ohne daß man den Kessel dadurch aͤndern duͤrfte. Der
Kohlen-Verbrauch ist 3 Hektolitres in 12 Stunden, d.h., ungefaͤhr 12 Franken.
Die Kohlen lassen beinahe gar keine Schlaken auf dem Roste, so daß der Heizer oft
den ganzen Tag lang nichts dabei zu thun hat, und die Thuͤre in den Ofen
nicht oͤffnen darf.
In einer Baumwollen-Spinnfabrike zu La Chapelle bei Paris befindet sich an einer
Dampfmaschine gleichfalls ein Ofen mit drehbarem Roste; allein an diesem Ofen ist,
statt des Schiebers ein Cylinder mit Laͤngenfurchen, welche eine gewisse
Menge Kohlen auf einmal aufnehmen.
Erklaͤrung der Figuren.
Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde.
Fig. 4. Plan
des Ofens und des Kessels in der Hoͤhe der Aschengrube.
Fig. 5. Aufriß
dieses Ofens von der Vorderseite.
Fig. 6. Ansicht
uͤber dem Schieber des Kohlenbehaͤlters und des Hebels, der denselben
abwechselnd oͤffnet oder schließt.
Fig. 7.
Seiten-Durchschnitt des Ofens und des Kessels nach der Linie AB des Grundrisses.
Fig. 8.
Senkrechter Durchschnitt nach der Linie CD.
Fig. 9. Rost
des Ofens von Oben.
Fig. 10.
Durchschnitt desselben Rostes und seiner Einfassung von Baksteinen.
AA, der Ofen;
B, der Kessel;
C, der Anhangs-Kessel oder Sieder (bouilleur), der mit dem Kessel Einen Koͤrper
bildet;
D, die Aschengrube;
E, Canal, durch welchen die Schlaken hinabfallen, die dem
Roste entgingen;
F, der sich drehende Rost aus geschlagenem Eisen, dessen
Stangen in der Mitte und an den Enden verduͤnnt sind;
G, der Mantel aus feuerfesten Ziegelsteinen, der den Rost
umgibt, und von einem eisernen Umschlage, oo,
gehalten wird;
H, kreisfoͤrmige mit trokenem Sande
gefuͤllte Rinne, in welchem sich der eiserne Rand pp dreht, und hindert, daß die Luft des Aschenloches auf keinem anderen
Wege als durch den Rost in den Ofen gelangt;
I, Kreuz von Eisen, auf welchem das ganze Sistem
ruht;
K, verticale Achse, welche den Rost dreht; das untere
Ende dieser Achse dreht sich als Zapfen in einem Zapfenlager aus Gußeisen.
L, senkrechte vorne am Ofen aufgerichtete Spindel, welche
von einem gegossenen eisernen Kerbrade, M, das auf ihrem
oberen Ende aufgezogen ist, bewegt wird.
Das Rad M wird von einem anderen Rade bewegt, welches
mittelst einer Trommel auf seiner Achse mit der Dampf-Maschine verbunden ist.
N, Drilling an dem unteren Ende der Spindel L;
O, Zahnrad, welches von dem Drillinge N bewegt wird.
P, ein anderes gegossenes auf der Achse K aufgezogenes Rad, in welches das Rad Oͤ eingreift. Dieses Rad dreht sich in zwei
Minuten einmal herum, und theilt seine Bewegung dem sich drehenden Roste mit.
R, Platte von gegossenem Eisen, welche das Rad P dekt, und dasselbe vor der durch den Rost
herabfallenden Asche und vor den Schlaken schuͤzt, damit sie nicht die
Bewegung desselben hindern;
S, Rumpf von Gußeisen, in welchen man die Steinkohlen
schuͤttet;
T, vierekige Buͤchse von Eisen, in welcher der
Schieber in einem Falze laͤuft;
U, Canal, durch welchen die Kohlen auf den Rost
fallen;
V, Zugroͤhren fuͤr die Flamme unter und um
den Kessel;
X, Schornstein;
Z, Woͤlbung des Ofens.
a, Thuͤre des Herdes, innenwendig mit Ziegeln
bekleidet;
b, kleine Thuͤre des Canales E, durch welche man die durch den Canal herabgefallene
Asche und die Schlaken wegschafft;
cc, kleine Thuͤrchen, die an den leeren Raum
um den Rost stossen, und die man oͤffnet, wenn man denselben reinigen
will;
dd, Haͤhne, durch welche man den Kessel
leert;
e, Daͤumlig an der Spindel L;
f, Hebel, dessen Mittelpunct der Bewegung f ist, und der an seinem vorderen Ende eine Pfote
traͤgt, auf welche der Daͤumling waͤhrend seiner Umdrehung
abwechselnd aufschlaͤgt. Dieser Hebel f ist mit
zwei Baͤndern versehen, welche den Schieber g,
der schief geneigt ist, um das Herabsteigen der Kohlen zu beguͤnstigen,
abwechselnd oͤffnen und schließen;
h, Klappe, die man gaͤnzlich schließt, wo man den
Ofen still stehen lassen will;
i, eiserne Stange, die mit einer Hand versehen ist, und
die Klappe bewegt;
k, Winkelhebel, der die Bewegung des Hebels f regelt, und der sich um den festen Punct k dreht;
l, Gegengewicht an dem aͤußersten Ende des vorigen
Hebels, der, indem er den Hebel f, wenn er von dem
Daͤumlinge befreit ist, in seine vorige Lage zuruͤkfuͤhrt, und
den Schieber g schließt;
m, ein Stuͤk Gußeisen mit Zapfenloͤchern,
in welchen sich die Zapfen der Baͤume L und des
Rades O drehen;
n, Buͤgel zur Befestigung und Aufrechthaltung des
Baumes k;
oo, eiserner Reifen, welcher die Ziegel-Bekleidung
GG umgibt;
pp, unterer Rand des Rostes, welcher sich in dem
mit Sande gefuͤllten Ringe HH dreht;
q, Regulator von Eisen, durch welchen die Weite der
Oeffnung des Schiebers g bestimmt wird;
v, Zapfenlager, zur Aufnahme des Zapfens des Drehe-Baumes
k.
Tafeln