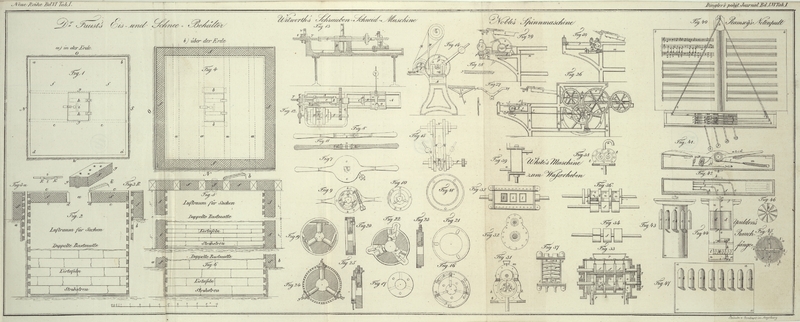| Titel: | Dr. Faust's Eis- und Schneebehälter: a) in, und b) über der Erde in Gebäuden. |
| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. X., S. 28 |
| Download: | XML |
X.
Dr. Faust's Eis- und Schneebehaͤlter:
a) in, und b) uͤber
der Erde in Gebaͤuden.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Dr. Faust's Eis- und Schneebehaͤlter.
Geschichtliches.
Im Sommer 1833, da ich den Gedanken: „Auch die Kaͤlte
in Eis und Schnee ist Kraft, eine der groͤßten in der Natur; und diese
Kraft zum Wohl der Menschen aufs Beste anzuwenden, ist die Kunst,“
hegte, ließ ich 2 Arten Behaͤlter, a) in, und b) uͤber der Erde, fuͤr Eis und Schnee und
zur Aufbewahrung von Sachen verfertigen. Gedanken und beide damals noch
unvollkommene Werke hatte ich die Ehre dem Architectenvereine in Berlin
mitzutheilen.
Der Winter 1833/1834 gab weder Eis noch Schnee. Erst 1835 wurde der, im Lichten 9 Fuß
8 Zoll hohe, oben 4 □ Fuß große Behaͤlter in einem Gebaͤude auf
hohem Walle in trokene, feste Erde eingegraben, und am 23. Januar mit Eistafeln, die
nur 3 Zoll dik, und nicht sehr fest und hart gefroren waren (am naͤchsten und
den folgenden Tagen trat Thauwetter und Regen ein), 6 Fuß hoch, die in den ersten 14
Tagen um 5 Zoll sich gesezt hatten, gefuͤllt. Wildpret wurde auf das mit
doppelter Bastmatte bedekte Eis gelegt.
Das Journal „das Ausland“ 16. Jul. 1834. Nr. 197, S. 785,
berichtet: die Eisausfuhr von Boston nach Calcutta (!!) am 6., 7. Mai 1833 bis zum
13.–16. September, in 4 Monaten, betrug 180 Tonnen (3600 Cntr.), wovon nach
Abzug des Geschmolzenen und des beim Ausschiffen und Wegfahren Verlornen 100 Tonnen
(2000 Cntr.) Eistafeln uͤbrig geblieben waren. Die Eistafeln waren 18 Zoll
dik, und in ihrem 50 Fuß langen Behaͤlter unten und zu den Seiten mit 1 Fuß
diken Tannenrinden und Brettern, oben mit dikem Heue isolirt.
Und in der Bremer Zeitung 1835. Nr. 18 heißt es: „Großbritannien, London
13. Januar. Lord William Bentinck hat dem Hrn. Rogers, dem Supercargo von dem amerikanischen Schiffe
Tuscany, eine schoͤne silberne Vase mit folgender Inschrift zum Geschenk
gemacht: „„Ueberreicht vom Lord William Bentinck, Generalgouverneur und Oberbefehlshaber von Indien, dem
Hrn. Rogers von Boston, als Anerkennung seines
Unternehmungsgeistes in der Einfuͤhrung der ersten Ladung
amerikanischen Eises in Calcutta.““ Und in der Bremer
Zeitung heißt es weiter: „Die gelandete Quantitaͤt Eis war 100
Tonnen (2000 Cntr.) Der Verkauf wurde zu 6 1/2 Centimen (ungefaͤhr 2
gGr.) per Pfund gemacht; die Eigener, die schwerlich mehr als
500 Dollars Auslage gehabt hatten, nehmen daher 12,500 Dollars
ein.“ (Mechanics' Magazine.)
Hr. Rogers
Im Polytechnischen Journale Bd. XIV. S.
410 wird eines Rob. Roggers,
Schiffmeisters und Schiffeigenthuͤmers zu New-Hampshire, der
sich 1823 ein Patent auf einen verbesserten Segelhalter hatte geben lassen,
erwaͤhnt. Sollte dieser Robert unser Rogers, dessen Vornamen Lord W. Bentinck nicht genannt hat, seyn? Wahrscheinlich.
Und wuͤrden auch Vor- und Zunamen vergessen, so bleiben That
und Lehre doch ewig. hat, was wohl wenige oder keine Menschen glaubten, durch seinen, gewiß von
Vielen verspotteten Eistransport von Boston um das Cap der guten Hoffnung nach
Calcutta, waͤhrend viermonatlicher Seefahrt, zwei Mal durch beide Wendekreise
und die Linie, in einer anhaltenden, dem Schiffe, nur nicht dem isolirten Eise, sich
mittheilenden Luft- und Meerwaͤrme von 24 und mehreren Graden Reaumur
bewiesen: daß Eis, wenn es gegen Waͤrme, selbst zwischen den Wendekreisen im
offenen Meere, geschuͤzt oder isolirt ist, welches leicht geschehen kann,
sich erhaͤlt, Eis bleibt, nicht zu Wasser wird.
Ein Jahr spaͤter, 1834, wie Zeitungen meldeten, hat ein anderes Schiff von
Nordamerika durch beide Wendekreise und die Linie Eis nach Rio-Janeiro
gebracht.
Beschreibung der Eisbehaͤlter.
A. In der Erde.
a) Oben in gleicher Flucht mit dem
Fußboden.
Fig. 1
ist eine Ansicht von Oben. Der Behaͤlter a, b,
c, d – ein unten offener Kasten aus dreizoͤlligen,
verzinkten Bohlen, am besten von Eichenholz, bei großen Maaßen
aͤußerlich durch Leisten gehoͤrig verstaͤrkt –
ist im Lichten (wie auch Fig. 4) 10 Fuß
□ oder 100 □ Fuß angenommen; e, e, f,
f sind 2 Bohlen, 3 Zoll dik, 1 Fuß hoch oder breit, durch 2 Riegel
mit einander verbunden, wodurch eine Luke 3 und 2 Fuß weit, 6 □ Fuß
gebildet wird. Die Klappe g, g uͤber der
Luke, die mit ihrer ganzen Dike 1 Zoll breit auf allen 4 Seiten in einen
Falz einschlaͤgt, ist 3 Fuß 2 Zoll und 2 Fuß 2 Zoll groß; h, h sind 2 unten eingeschobene Leisten; i ist ein Riemen, um von Innen die Klappe
schließen zu koͤnnen. Banden, Ueberfall und Ring ergeben sich von
selbst.
Fig. 2
ist ein Durchschnitt des Behaͤlters von Norden nach Suͤden.
a ist die geoͤffnete Luke, 2 Fuß
weit; b die aufgeschlagene Klappe; c, c die Verschalung, die bei d, d auf allen 4 Seiten 1 Zoll weit in die Luke
hervorspringt, und auf welchem Vorsprunge die Haͤkselmatraze ruht;
e, e die Bedielung; zwischen Verschalung und
Bedielung 1
Fuß hoch Raum mit Haͤkerling, 1/4 Zoll lang von Roggenstroh, f, f, dicht gefuͤllt (in allen folgenden
Figuren ist der Haͤkerling mit f, f
bezeichnet); g, g eine Matraze, 3 und 2 Fuß
breit, 1 Fuß hoch, von Leinewand, bestehend in Unter- und
Ober- und 4 Seitenblaͤttern, mit Haͤkerling fest
ausgestopft, durchgenaͤht, und an jeder schmalen Seite mit einem
Handgriffe von vierfach zusammengelegtem und genaͤhtem Leinen, der
uͤber das obere und untere Blatt hervorragt, versehen; da der
Behaͤlter 100, die Luke 60 □ Fuß groß ist, so bleiben bei
geoͤffneter Luke 94 □ Fuß verschlossen, und sehr wenige Luft
dringt in den Behaͤlter ein; auch kann man, wenn man vermittelst
einer kleinen Treppe in den durch Lampe oder Kerze erleuchteten Luftraum
uͤber dem Eise herabgestiegen ist, die Klappe hinter sich zumachen;
denn Luft zum Athmen ist genug da, und die Lampen geben der Finsterniß im
Behaͤlter Licht. c, die Klappe im
Durchschnitt, wo k, k, die 2 eingeschobenen
Leisten, und l, der Riemen, unter der Klappe
sichtbar sind.
b) In und uͤber der Erde.
Fig.
3. A, B. Der unten abgebrochene
Behaͤlter steht groͤßten Theils in, und zum Theil, hier 3 Fuß
hoch, uͤber der Erde, wo er mit Bretterwaͤnden und 1 Fuß dikem
Haͤksel umgeben ist. Dieses dient da, wo im Verhaͤltniß zur
Hoͤhe des Behaͤlters der Grund und Boden nicht tief genug
troken und fest ist, dem Behaͤlter eine groͤßere Hoͤhe
zu geben.
B. Ueber der Erde.
Diese uͤberirdischen Behaͤlter befinden sich im ersten oder
untersten Stokwerke eines Gebaͤudes, Hauses, Scheune, Remise, nur nicht
Stalles, wo der Behaͤlter unten auf bloßer Erde aufsteht; –
waͤre Beschuß von Dielen oder Steinplatten da, so muß derselbe
weggenommen werden, damit, wenn etwas Eis im Anfange schmelzen wuͤrde,
das Wasser in die Erde sich verlieren kann. Der Behaͤlter ist in der
ganzen Hoͤhe des ersten Stokwerkes mit Waͤnden, den
natuͤrlichen des Gebaͤudes, oder kuͤnstlichen von
duͤnnen Brettern, die 1 Fuß weit von ihm abstehen und mit Haͤksel
gefuͤllt sind, umgeben, und hat zwischen den Dekenbalken in dem zweiten
Stokwerke eine Oeffnung.
Fig. 4 ist
eine Ansicht von Oben, wo zugleich die Luke mit Klappe, die Dekenbalken zwischen
dem ersten und zweiten Stokwerke a, a, a, a, 1 Fuß
hoch, 8 Zoll breit, die 2 Riegel der Luke, b, b, und
der Haͤkerling, f, f, f, f, 1 Fuß dik,
zwischen Behaͤlter und Waͤnden angegeben sind.
Fig. 5 ist
ein Durchschnitt des in der Mitte durchbrochenen, 10 Fuß hohen
Behaͤlters, der zu den Seiten und oben zwischen Dekbalken, Verschalung
und Bedielung, 1 Fuß dik, mit Haͤkerling umgeben und dessen im zweiten
Stokwerke sich oͤffnende Luke mit der Haͤkerlingmatraze
geschlossen ist.
Fig. 6 ist
ein Durchschnitt des uͤberirdischen, oben abgebrochenen Behaͤlters
mit Haͤkselumkleidung, der mehrere, hier 3 Fuß tief in die Erde
hinabgeht. Dieses dient da, wo das erste oder unterste Stokwerk des
Gebaͤudes fuͤr die verlangte Hoͤhe des Behaͤlters
nicht hoch genug ist, zur Verlaͤngerung der Hoͤhe; und es kann der
unterirdische Theil des Behaͤlters so tief als der Grund und Boden troken
und fest, oder gut ist, in die Erde gehen. Waͤre z.B. das Stokwerk 10 Fuß
hoch, und die Erde 6 Fuß tief troken und gut, so kann der Behaͤlter 16
Fuß hoch seyn.
Die Erde muß da, wo die Behaͤlter in der Erde gaͤnzlich liegen,
oder zum Theil in sie hinabgehen, 3–4 Fuß tiefer, als die Soole des
Behaͤlters troken und fest seyn, damit im Verlaufe der Zeit kein Wasser
sich in den Behaͤlter ziehe.
Solche Eis- und Schneebehaͤlter, deren raͤumliche
Groͤße nach Beduͤrfniß, Umstaͤnden, Willen und Lust sich
richtet, koͤnnen in oder uͤber der Erde in allen Gebaͤuden, wo freier Raum ist (dieser, wenn man ihn
sucht, findet sich leicht), in Zeit von 2, 3 Wochen mit leichter Arbeit und
Muͤhe angelegt werden.
Gute Behaͤlter sollten wenigstens 8 Fuß tief seyn, damit uͤber dem
Eise genug Luftraum fuͤr Sachen uͤbrig bleibt.
Die Eistafeln, wenn strenge, anhaltende Winter, wo die Erde eine Schneedeke hat,
sie geben, sollten, mit Saͤge in gehoͤriger Groͤße
geschnitten, sehr hart und fest gefroren, 6, 9, 12 Zoll dik (Hrn. Roger's Tafeln waren 18 engl. Zoll dik), an kalten
Tagen gesammelt, in den Behaͤlter gebracht und sehr genau auf einander
gelegt seyn und werden.
Wo es kein Eis gibt, wird Schnee! in 3–4 zoͤlligen Schichten, die
mit lauem Wasser, worin Kochsalz, Salpeter und Salmiak aufgeloͤst sind,
koͤnnen begossen werden, aufs staͤrkste festgestampft; wo dann der
Schnee im Behaͤlter in einen festen Eiskoͤrper sich
verwandelt.
Je groͤßer die Menge oder Masse des Eises, besonders in der Hoͤhe,
oder in Wuͤrfelgestalt ist; desto besser erhaͤlt sich das Eis oder
die Eiskaͤlte, und desto wehr vermindert sich die Waͤrme um den
Behaͤlter und in dessen Luftraume.
Die Behaͤlter von 6, 8, 10 oder mehreren Quadratfuß, deren untere
Haͤlfte 4, 5, 6 Fuß hoch mit Eistafeln, die unten auf einer 3 Zoll hohen
Strohstreu ruhen und oben mit einer doppelten Bastmatte, in welchen Kaffee aus der
Havannah kommt, bedekt sind, gefuͤllt, und deren obere Haͤlfte
Luftraum ist, haben zwei Zweke: 1) Eis, in so weit es nicht verbraucht ist, von
Winter zu Winter und laͤnger unfehlbar aufzubewahren (das zum Theil
verbrauchte Eis wird im naͤchsten Winter ersezt); und 2) die Aufbewahrung
von Sachen aus dem Thier- und Pflanzenreiche in dem geschlossenen kalten
Luftraume uͤber dem Eise.
I. Eis. Dieses hat den groͤßten Nuzen. 1)
Wasser und Getraͤnke, deren Waͤrme in heißen Laͤndern und
zu heißer Sommerszeit, auch bei Fleischnahrung und Wein, zu groß ist,
kuͤhl und erquikend zu machen; 2) Gefrornes, das groͤßte Labsal
heißer Laͤnder und Sommer, auf die vielfachste Art leicht und wohlfeil
zuzubereiten; 3) Fieberkranken kaltes Wasser, als Hauptheilmittel der Fieber
(vielleicht auch des gelben Fiebers und der Cholera) darzureichen; und 4) bei
schweren Wunden, Verlezungen und Knochenbruͤchen zur Verhuͤtung
großer Entzuͤndungen und Schmerzen, gleich im Anfange
Eisumschlaͤge zu machen, die aber, man merke es wohl, bei Entstehung von
Hize in und um den beschaͤdigten Theil gleich zu unterlassen und mit
warmen Umschlagen zu verwechseln sind.
II. Aufbewahrung von Sachen. Dieser Zwek der
Behaͤlter ist gleichfalls von der hoͤchsten Wichtigkeit und dem
groͤßten Nuzen. In der ruhigen stillstehenden, sehr wenig
duͤnstigen, kuͤhlen Luft des geschlossenen Behaͤlters,
deren Waͤrme 1, 2, 3 Grad R. betraͤgt, friert zu Eis nichts,
verdirbt nichts; duͤnsten die Sachen sehr wenig aus, troknen und
schrumpfen fast gar nicht ein, behalten Saft und Kraft; nichts treibt und keimt;
nichts geht in Gaͤhrung und Faͤulniß uͤber; und alle Sachen
erhalten sich viele Monate lang, auch in der heißesten Sommerszeit, trokene
Sachen Jahre hindurch in ihrem natuͤrlichen, gesunden Zustande; z.B.
Brod, rohe, gekochte, gebratene Speisen, Fleisch, Wildpret, Gefluͤgel,
Fische, Austern, Eier, Saͤmereien, Gemuͤse, Sallat, Spargel,
gruͤne Erbsen in Schoten, Obst, Kirschen, Weintrauben, Seidenraupeneier,
daß sie nicht fruͤher, als bis der Maulbeerbaum Laub hat, ausgehen, und
unzaͤhlige Sachen fuͤr Haushalt und Leben.
Eiszimmer: z.B. 30 Fuß lang, 20 Fuß breit, 12 Fuß
uͤber, 6 Fuß in der Erde, unten 6 Fuß Eis, geebnet, daruͤber
doppelte Bastmatten, Bretter und Teppich, der große, 12 Fuß hohe Luftraum bei
geschlossener Luke hell und prachtvoll erleuchtet; Essen, Trinken, Eispunsch,
Gefrornes, Musik und Gesang: da zu jeder, besonders heißer Sommerszeit, bei Tag
und in der Nacht: da waͤre Freude, waͤre ein Heiliges. –
Solche Eiszimmer koͤnnten wohl auch manchen Kranken sehr angenehm, ja
heilsam seyn.
Daß Eisbehaͤlter allen guten Haushaltungen in Stadt und Land,
Gasthoͤfen und Krankenhaͤusern vom groͤßten Nuzen, ja eine
Hauptvervollkommnung des Haushalts – zum Schweiße
Eis – seyn koͤnnten, leuchtet ein.
Die Menschen muͤssen durch Erfahrung und Beispiele nur erkennen lernen,
wissen und verstehen, die Eisbehaͤlter auf das Beste zu erbauen,
anzuwenden und zu benuzen, und an Eisbehaͤltern, selbst dort in Liberia, wird es dann nicht fehlen.
Die Eisbehaͤlter werden einstens, nach seliger Zeit voll Arbeit und
Muͤhe, zur Freiheit und Civilisation der Menschen und, wie Vitruv sagte,
ad voluptatem et elegantiam vitae beitragen
helfen.
Ja! auch die Kaͤlte ist
Kraft!
Auch
Kraft die Sonne!!
Buͤckeburg 8. Febr. 1835.
B. C. Faust, Dr. Hofrath und Leibarzt, Ritter des rothen Adlerordens 3ter
Classe, Ehrenbuͤrger der Stadt Buͤckeburg, und Mitglied
mehrerer gelehrten Gesellschaften.
Tafeln