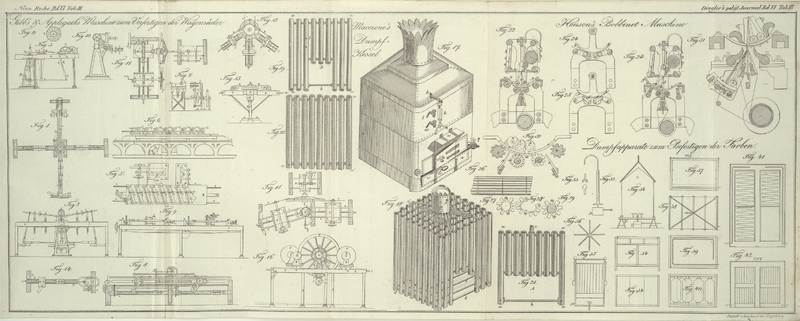| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Ausschneiden hölzerner Wagenräder und zum Formen der Räder, worauf sich Joseph Gibbs, Ingenieur von Kent Road, und August Applegath, Calicodruker von Crayford, in der Grafschaft Kent, am 22. September 1832 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. XXXII., S. 183 |
| Download: | XML |
XXXII.
Verbesserungen an den Maschinen zum Ausschneiden
hoͤlzerner Wagenraͤder und zum Formen der Raͤder, worauf sich
Joseph Gibbs, Ingenieur
von Kent Road, und August
Applegath, Calicodruker von Crayford, in der Grafschaft Kent, am 22. September 1832 ein Patent ertheilen
ließen.Wir haben schon Bd. XLVIII. S. 463
Nachricht von diesem Patente gegeben, und bedauern bei dem Lobe, welches den
Maschinen der Patenttraͤger in England gezollt wird, nur die
Unvollstaͤndigkeit der Beschreibung, die durch den kleinen Maßstab der
beigefuͤgten Zeichnungen eher vermehrt als gehoben wird. A. d. R.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions.
Maͤrz 1835, S. 141.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Verbesserte Maschinen zum Ausschneiden hoͤlzerner
Wagenraͤder und zum Formen der Raͤder.
Unsere Erfindungen, sagen die Patenttraͤger, sind in folgender Beschreibung
der auf Tab. III abgebildeten Maschinerien begriffen.
Nachdem die Nabe abgedreht und das Mittelloch auf die gewoͤhnliche Weise in
derselben ausgebohrt worden, werden die Zapfenloͤcher, die zur Aufnahme der
Speichen bestimmt sind, mittelst einer Maschine ausgebohrt, welche man in Fig. 1 im
Grundrisse und in Fig. 2 in einem Seiten- und Endaufrisse ersieht, waͤhrend
Fig. 3
eine andere Seitenansicht derselben gibt. An allen diesen Figuren beziehen sich
gleiche Buchstaben auch auf gleiche Gegenstaͤnde.
A, A, A, A ist das gußeiserne Gestell. B, B, B die Spindel oder Doke, auf der die Nabe
befestigt ist, und die mit einer Theilungsplatte C
versehen ist, von deren Mittelpunkt Fugen oder Eintheilungen auslaufen, welche auf
folgende Weise zur Regulirung der Stellung der Zapfenloͤcher dienen. An dem
Ende der gegliederten Stange E, welche sich in den
Fuͤhrern F, F bewegt, und welche mit dem
Winkelhebel G, der in Fig. 3 durch punktirte
Linien angedeutet ist, in Verbindung steht, ist ein Einfallzapfen D befestigt. So wie sich der Winkelhebel G umdreht, bewegt sich die Stange E und der an ihrem Ende angebrachte Zapfen D
gegen die Spindel B hin oder von denselben weg. H ist eine Reibungsrolle oder ein kleines Rad, welches
sich auf oder an dem aͤußeren Rande oder Reifen der Theilungsplatte C bewegt, und durch einen von dem Rigger I herlaufenden Laufriemen in Thaͤtigkeit gesezt wird. Wenn nun der
Einfallzapfen D nach Ruͤkwaͤrts aus den
strahlenfoͤrmigen Fugen der Theilungsplatte C
ausgezogen wird, so kann sich die Theilungsplatte frei umdrehen; sie wird auch von
der Reibungsrolle H in der Richtung der Pfeile herum
bewegt, bis der Zapfen D, der sich fortwaͤhrend
in Verbindung mit dem Winkelhebel G bewegt, in die
naͤchste strahlenfoͤrmige Fuge trifft, wo dann die Bewegung der
Theilungsplatte C durch den Zapfen D angehalten wird, waͤhrend der Winkelhebel G den Einfall oder Zapfen D
in der strahlenfoͤrmigen Fuge abwaͤrts gegen den Mittelpunkt der
Spindel bewegt. Zu gleicher Zeit geschieht nun das Ausbohren der
Zapfenloͤcher mittelst der kreisenden Bohrer K, K,
K, welche die gewoͤhnliche Gestalt haben koͤnnen, und an den
Enden der Stangen oder Wellen L, L, L befestigt sind,
denen mit Huͤlfe eigener, von den Riggern M, M, M
herfuͤhrenden Laufbaͤnder eine drehende Bewegung mitgetheilt wird. Die
Bohrer K, K, K dringen in die Nabe, waͤhrend sich
der Zapfen D mittelst der an den oberen Enden der
Winkelhebel N, N, N befindlichen Gabeln in der
strahlenfoͤrmigen Fuge herab bewegt. Die zulezt erwaͤhnten Hebel N, N, N erhalten ihre Bewegung von der an dem Ende des
Hebels P befindlichen Gabel O, Fig.
3, mitgetheilt; und dieser Hebel P steht durch
die Stangen Q, R mit den Armen R,
R des Winkelhebels G in Verbindung, so daß sich
der Zapfen D und die Bohrer K, K,
K zu gleicher Zeit gegen den Mittelpunkt hin und von demselben weg bewegen.
Diese abwechselnd kreisende und bohrende Bewegung dauert so lange fort, bis die Nabe
rings herum ausgebohrt worden ist. Ist dieß der Fall, so wird die Bewegung der Welle
oder Spindel J, an der der Rigger I aufgezogen ist, angehalten, und die Nabe zum Behufe des Bohrens eines
zweiten Kreises von Loͤchern mittelst der aus Fig. 2 und 3 ersichtlichen Schrauben
und Schraubenmuttern emporgehoben, so daß man also auf diese Weise eine beliebige
Anzahl von Loͤcherkreisen ausbohren kann, bis die Zapfenloͤcher die
gehoͤrige Laͤnge erlangt haben. Sollte es noͤthig seyn, so
koͤnnen die Zapfenloͤcher noch mit der Hand weiter ausgeschnitten
werden. In Fig.
1 sieht man eine Theilungsplatte C, so wie sie
zur Erzeugung eines Rades mit zwoͤlf Speichen erforderlich ist; soll das Rad
14 oder mehr Speichen bekommen, so muß die Theilungsplatte C, welche man in Fig. 4 einzeln abgebildet
sieht, 14 oder mehrere solche strahlenfoͤrmige Fugen oder Eintheilungen
haben. In diesem Falle muß das bewegliche Ende der Maschine, welches in Fig. 1 mit 1
bezeichnet ist, mittelst des Segmentes V auf den
gehoͤrigen Winkel gestellt und mit der Spannschraube W fixirt werden. Dieses bewegliche Ende dreht sich an der Spindel B. Die Bewegung wird an die beiden Laufbandrollen oder Rigger,
welche an der Spindel J angebracht sind, fortgepflanzt;
und an dieser Spindel ist auch das Getrieb X aufgezogen,
welches in das an der Winkelwelle G befindliche Zahnrad
Y eingreift. Auch die Laufbandraͤder der
Bohrstangen L, L, L werden in Bewegung gesezt. Die
Stuͤzpunkte der Winkelhebel N, N sind an den
Armen Z, Z stellbar. Die Stangen L, L, L, werden von den Lagern oder Haͤusern S, S gefuͤhrt, und diese bewegen sich an Mittelstiften, welche an
den Enden der stellbaren Schraubenstangen T, T befestigt
sind, so daß die Loͤcher in den erforderlichen Winkeln gebohrt werden
koͤnnen.
Die Speichen werden auf die gewoͤhnliche Weise gespalten und roh geformt; das
Erste ist dann, daß an dem Nabenende der Zapfen geschnitten wird. Fig. 5 gibt einen Grundriß
der Maschine, in welchen diese Zapfen an den Nabenenden der Speichen geschnitten
werden. Fig. 6
ist eine Seiten- und Fig. 7 eine Endansicht
ebendieser Maschine. An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auch
auf gleiche Gegenstaͤnde. A ist das gußeiserne
Gestell. B das schiebbare Lager, welches sich auf den
Schienen oder Riegeln C, C bewegt, und mit einer Anzahl
beweglicher Wagen versehen ist, auf die die darauf gelegten rohen Speichen mittelst
der Boͤke E, E niedergehalten werden. Diese Wagen
drehen sich um die Mittelstifte F, F; und sind durch die
Stange G mit einander verbunden, mit welcher sie auch so
in Bewegung gesezt werden, daß ein vollkommener Parallelismus derselben, dessen
Winkel mittelst des gezahnten Kreissegmentes H bestimmt
wird, erhalten wird. I, I sind zwei an derselben Welle
oder Spindel aufgezogene kreisfoͤrmige Saͤgen, die man besonders in
Fig. 7
sieht, und welche mittelst des Riggers J in Bewegung
gesezt werden. Der Wagen der Saͤge und die Spindel K kann mittelst der Stellschraube L gehoben
und gesenkt werden. Z ist eine an einem der Wagen D, D
fixirtesixirte Speiche, an der der Zapfen geschnitten wird, sobald sie durch die Bewegung
des Lagers B in den Bereich der kreisrunden
Saͤgen I, I gekommen ist. Auf diese Weise
koͤnnen also so viele Zapfen auf ein Mal geschnitten werden, als sich Wagen
auf dem Bodenlager befinden. Dieses bewegliche Lager B
ist mit einer Zahnstange M, M versehen, in welche das
Getrieb N eingreift; an derselben Welle, wie lezterer,
befindet sich aber auch noch das Rad O, in welches ein
anderes Getrieb P eingreift. An der Spindel von P befinden sich zwei lose Rigger Q, Q; von diesen dient der eine groͤßere dazu dem Lager eine
langsame Bewegung nach Vorwaͤrts zu geben, waͤhrend die Zapfen
geschnitten werden; der andere kleinere hingegen macht das Lager mit rascher
Bewegung wieder zuruͤkkehren. An einer Feder in der Spindel von P bewegt sich eine doppelte Klauenbuͤchse, welche
abwechselnd bald mit dem großen, bald mit dem kleinen Rigger in Verbindung
kommt.
Fig. 8 ist ein
Grundriß einer Maschine zum Formen der Speiche; Fig. 9 ist ein
Seiten- und Fig. 10 ein Endaufriß derselben. Gleiche Buchstaben beziehen sich auch
hier auf gleiche Gegenstaͤnde. A ist das
gußeiserne Lager oder der Wagen, der wie das Lager einer Drehebank zwei Rippen oder
Schienen hat. B, B sind Wagen oder Dokenhaͤupter.
C, C sind Wagen mit beweglichen Mittelstiften. D, D sind Wangen, welche an den Doken B, B befestigt sind, und welche zur Aufnahme des inneren
oder Nabenzapfens einer Speiche dienen. E ist die
Musterspeiche, welche eine beliebige Form haben, und aus Holz, Messing, Eisen oder
irgend einem anderen zwekmaͤßigen Materiale verfertigt seyn koͤnnen.
F ist die rohe Speiche, in welche bereits der eine
Zapfen geschnitten worden. Die Dokenhaͤupter B, B
sind mit Zahnraͤdern versehen, denen mittelst der an der Spindel H befestigten Getriebe G, G
und durch Zwischengetriebe dieselbe Bewegung mitgetheilt wird, wie sie oben
beschrieben worden sind, so daß, wenn sich ein Dokenhaupt umdreht, auch das andere
sich zugleich mit umdreht. Die Spindel H wird durch ein
um den Rigger I laufendes Darmsaitenband in Bewegung
gesezt. K ist ein gußeisernes Bett oder Lager mit zwei
Riegeln oder Schienen, auf denen sich der bewegliche Wagen L ruͤk- und vorwaͤrts bewegt, indem das an dem
gußeisernen Gestelle K befestigte Getrieb N in dessen Zahnstange M
eingreift. Das Getrieb N wird durch zwei Rigger Y und Z, welche sich an
dessen Spindel befinden, und durch eine doppelte Klauenbuͤchse in Bewegung
gesezt. O ist eine Art von Kloben, dessen beide Arme
sich um den Mittelzapfen P bewegen, und eine glatte, an
einer aufrechten Spindel aufgezogene Walze Q
fuͤhren. Der Kloben O hat aber auch noch einen
anderen Arm R, der mit ersteren einen rechten Winkel
bildet, und der durch die Stange S mit einem anderen
Arme R des Klobens T in
Verbindung steht. Dieser leztere Kloben dreht sich gleichfalls um einen Mittelzapfen
P; er fuͤhrt aber auch ein cylindrisches
Schneidinstrument U, in dessen Umfang Zaͤhne
geschnitten sind, und welches zum Formen der Speichen dient. Dieses
Schneidinstrument U wird durch ein uͤber die
Rigger V und W gehendes
Laufband in rasche kreisende Bewegung versezt. Waͤhrend die Maschine in
Thaͤtigkeit ist, wird die Spindel H in Bewegung
gesezt, wodurch die Raͤder und Dokenhaͤupter und Wangen, so wie die in
ihnen befestigten Musterspeichen und rohen Speichen umgedreht werden. Zugleich
bewegt sich der Wagen L mit seinem Schneidinstrumente in
rascher Bewegung ruͤk- und vorwaͤrts, wodurch die rohe Speiche
spiralfoͤrmig zugeschnitten wird, bis sie die gehoͤrige Form erlangt hat; und
wenn die glatte Walze Q auf der Musterspeiche aufruht,
hoͤrt das Schneiden auf. Das Schneidinstrument U
kann durch ein Gewicht an die rohe Speiche angedruͤkt werden. Die doppelte
Klauenbuͤchse X, welche sich an der Spindel des
Getriebes N befindet, wird mit den Riggern V und W in Verbindung
gebracht, und zwar mittelst der an der Stange b
angebrachten Finger oder Daͤumlinge a, a, welche
auf das Ende c des rechtwinkeligen Hebels d treffen; dieser leztere Hebel dreht sich um die Achse
e, und steht auf die gewoͤhnliche Weise durch
ein Gelenkstuͤk f mit dem Stoßhebel der
Klauenbuͤchse x in Verbindung.
Fig. 11 ist
ein Grundriß der Maschine, in welcher der Zapfen am aͤußeren Ende der Speiche
geschnitten wird. Die Speichen werden auf die gewoͤhnliche Weise in die Nabe
getrieben. A ist das gußeiserne Gestell mit zwei Riegeln
oder Schienen B, B, auf denen die Wagen C und D ruhen. Der Wagen C ist mit einer Spindel E
versehen, welche sich in Zapfenlagern umdreht, und an der sich das Zahnrad F befindet. In dieses Zahnrad F greift ein Getrieb G, welches durch einen an
seiner Spindel angebrachten Nigger H in kreisende
Bewegung gesezt wird. Das Radende der Spindel E hat
dieselbe Groͤße wie die Doke B in Fig. 1, welche zur
Aufnahme der Nabe dient. Wenn die Nabe und die Speichen an dem Ende von E fixirt sind, so wird, um die Speichen waͤhrend
des Schneidens der aͤußeren Zapfen ganz staͤtig zu erhalten, das
Radgerippe I mittelst der Stellschraube L und des Fuͤhrers M
gegen die Speichen angedruͤkt. Dieses Rad I ist
an einer kreisenden Spindel oder Welle J angebracht, die
von dem Gestelle K, K getragen wird. Das Schneiden der
Zapfen selbst wird auf folgende Weise vollbracht. Der Wagen D hat eine Spindel oder Doke N, an der sich
zwei kreisrunde Saͤgen O, P befinden, von denen
die eine P an ihrer konischen Flaͤche
gezaͤhnt ist. Die Spindel N und ihre kreisrunden
Saͤgen werden in rasche kreisende Bewegung versezt, und zu gleicher Zeit
bekommen die Nabe und die Speichen mit dem Radgerippe eine langsame kreisende
Bewegung, wodurch die Speichen nach einander mit den kreisrunden Saͤgen O, P in Beruͤhrung gebracht werden, die die
Zapfen in die Speichen schneiden. Der Wagen D hat zwei
Bewegungen: die eine gegen die Radspindel E und von
derselben weg, welche durch die Schraube Q
hervorgebracht wird, und die andere nach Ruͤk- und Vorwaͤrts in
der Richtung der Spindel N, die ihr durch eine andere
Schraube R mitgetheilt wird. Der Wagen selbst ist nach
Art der Vorlage einer Drehebank eingerichtet. Die Spalte fuͤr den Keil,
welche in dem aͤußeren Ende des Zapfens angebracht wird, kann gleichfalls in dieser
Maschine, und zwar mittelst der kreisrunden Saͤge O geschnitten werden.
Die in Fig. 5,
6 und 7 ersichtliche
Maschine kann mittelst einer kreisrunden Saͤge, welche auf die aus Fig. 5
erhellende Weise angebracht wird, auch zum Schneiden der Enden der Felgen angewendet
werden, d.h. um ihnen die gehoͤrige Laͤnge und den gehoͤrigen
Radius zu geben. R ist eine kreisrunde Saͤge und
S eine auf den beschriebenen Wagen D gebrachte Felge, welche durch den Bok E in der zum Schneiden erforderlichen Stellung
niedergehalten wird. Die Saͤge R wird durch ein
uͤber den Rigger T laufendes Band in Bewegung
gesezt.
Fig. 12 ist
ein Grundriß einer Maschine zum Bohren der Loͤcher in den Enden der Felgen.
Fig. 13
ist ein Fronteaufriß derselben. A ist das gußeiserne
Gestell, welches von den beiden Pfeilern B und C getragen wird. D, D ist
ein doppelwinkeliges Lager oder Bett, auf dem sich die bohrenden Wagen E, E befinden. Das winkelige Lager D, D kann sich an dem mittleren Pfeiler B bewegen, so daß die Bohrspizen F, F abwechselnd an die Enden der Felge G, G
gelangen, die auf dem Lager H festgemacht und durch
einen Bok oder auf irgend eine andere Weise darauf festgehalten wird. Das Lager H kann mittelst der Schraube I gegen den Mittelpfeiler B hin gebracht oder
von demselben entfernt werden, und die Bohrwagen lassen sich mittelst der Schrauben
J, J gleichfalls so stellen, daß sie dem Radius der
Felgen von verschiedener Groͤße entsprechen. Die Bohrspizen F, F werden auf folgende Weise in Bewegung gesezt. Der
mittlere Pfeiler B hat ein genau abgedrehtes Ende, und
ist mit drei Riggern ausgestattet, die sich frei um denselben drehen, und von denen
die beiden unteren mit einander verbunden oder auch aus einem Stuͤke gegossen
sind. Der mittlere Rigger wird durch das Laufband L
umgetrieben, und bewirkt, daß sich auch der untere Rigger zugleich mit ihm umdreht.
Das Band K, K laͤuft uͤber die an den
Spindeln der Bohrspizen F, F befindlichen Rigger, und
gegen die oberen und unteren an dem Pfeiler B
befindlichen Rigger. Da nun der untere Rigger durch seine Verbindung mit dem
mittleren Rigger zu Umdrehungen veranlaßt wird, so sezt er auch das dagegen
bruͤtende Band K, K in Bewegung, und dadurch wird
die Bewegung des Bandes L, L auf die Bohrspizen
uͤbergetragen. Der winkelige Wagen D, D wird von
einem Arbeiter auf dem Bette der Felge bewegt. Die Loͤcher oder
Zapfenloͤcher der Felgen, welche zur Aufnahme der Speichen bestimmt sind,
koͤnnen gleichfalls auf dieselbe Weise gebohrt werden, indem man die Stellung
des Lagers H und der darauf befindlichen Felge abaͤndert, wie dieß
in Fig. 12
durch punktirte Linien angedeutet ist.
Die auf diese Weise ausgebohrten Speichenloͤcher werden in einer Maschine, die
man in Fig.
14 im Grundrisse sieht, vollendet und vierekig gemacht. A ist das gußeiserne Gestell. B,
B sind zwei Riegel oder Schienen, welche das Lager C tragen, auf dem die Felge festgemacht wird. Die spießfoͤrmige
oder vierekig zulaufende Feile E steht mittelst der
Fuͤhrstange F und des Gefuͤges H mit der Kurbelstange G in
Verbindung, so daß, wenn sich der Winkelhebel I umdreht,
die Feile in dem Loche der Felge ruͤk- und vorwaͤrts bewegt
wird. Der Winkelhebel wird durch ein Laufband, welches uͤber die bewegliche
und unbewegliche Rolle K, K laͤuft, in
Thaͤtigkeit gesezt. Das Lager C laͤßt sich
mittelst der Schraube L stellen.
Wenn nun die Felgen vollendet und die Speichen auf die gewoͤhnliche Weise
darin befestigt und verkeilt sind, so wird das Rad vollendet, indem man die Seiten
der Felgen in einer Maschine formt, die man in Fig. 15 im Grundrisse,
und in Fig.
16 im Aufrisse sieht. A ist das gußeiserne
Gestell. B, B zwei Lager, welche die
kreisfoͤrmigen Saͤgen fuͤhren; diese sind endwaͤrts oder
in der Richtung ihrer Spindeln stellbar, indem sie nach Art eines Schieberhaspels
mit Schrauben und Schiebern versehen sind. Ein Theil des gußeisernen Gestelles A kann mittelst des Segmentes und einer Stellschraube
E um den Mittelzapfen D
bewegt werden, damit hiedurch die Stellung der kreisrunden Sage F der erforderlichen Stellung des Rades angepaßt werde.
Die kreisrunden Saͤgen werden mittelst Laufbaͤnder, die uͤber
die Rigger G, G gehen, in Bewegung gesezt. Die Lager B, B werden mittelst der Winkelraͤder H, H, H und der Schrauben C,
C, von denen die eine recht- und die andere eine linkhandige ist,
gegen den Mittelzapfen hin und von demselben weg bewegt. An dem Mittelzapfen D befinden sich zwei Winkelraͤder I, I, durch welche die Lager B,
B in Bewegung gesezt werden, und wodurch auch die Saͤgen veranlaßt
werden, sich vorwaͤrts gegen das Rad zu bewegen. J,
J ist das gußeiserne Gestell, welches das Lager K traͤgt, und in welchem sich auch die Zapfenlager fuͤr die
Welle L befinden. An dieser Welle ist das Zahnrad M angebracht, und in dieses greift ein Getrieb, welches
durch ein um den Rigger O gezogenes Laufband umgetrieben
wird. An dem Ende der Welle L ist ferner das Rad P aufgezogen, welches sich umdreht, sobald der Rigger
O in Bewegung kommt; zugleich kommen aber auch die
Saͤgen F, F in rasche Bewegung, und auf diese
Weise wird dem Rade mit voller Genauigkeit die gehoͤrige Form gegeben. Das
Bereifen des Rades geschieht nach der gewoͤhnlichen Methode.
Tafeln