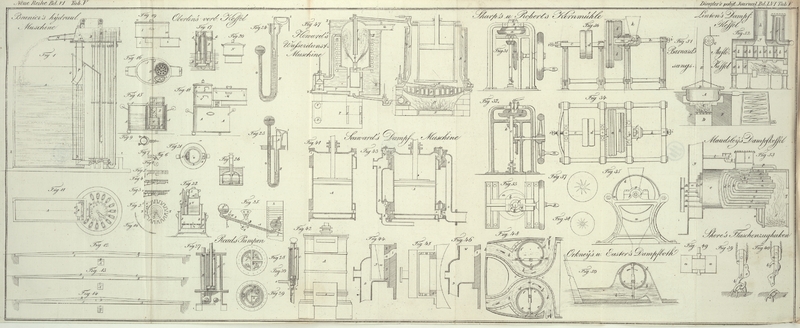| Titel: | Verbesserte Kessel, welche sich zu mannigfachen Zweken anwenden lassen, und auf welche sich Leopold Oberlin, Kaufmann am Leicester-Square, Grafschaft Middlesex, am 18. Januar 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. XLVI., S. 264 |
| Download: | XML |
XLVI.
Verbesserte Kessel, welche sich zu mannigfachen
Zweken anwenden lassen, und auf welche sich Leopold Oberlin, Kaufmann am
Leicester-Square, Grafschaft Middlesex, am 18.
Januar 1834 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions.
Maͤrz 1835, S. 161.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Oberlin's verbesserte Kessel.
Die unter meinem gegenwaͤrtigen Patente begriffenen Verbesserungen haben den
Zwek in einzelnen Gefaͤßen oder Orten jede beliebige, innerhalb gewisser
Graͤnzen stehende Temperatur gleichmaͤßig zu unterhalten. Sie finden
ihre Anwendung hauptsaͤchlich an jenen Kesseln, deren man sich zum Sieden des
Wassers fuͤr den Kuͤchengebrauch bedient; doch lassen sie sich auch
auf solche Kessel anwenden, in denen eine Fluͤssigkeit auf einen niedrigeren
sowohl als hoͤheren Temperaturgrad, als er dem siedenden Wasser eigen ist,
erhizt werden soll; und eben so lassen sie sich unter gewissen Umstaͤnden
auch zum Heizen von Treibhaͤusern, Werkstaͤtten, Wohnhaͤusern
etc. benuzen. Sie bestehen in gewissen Apparaten, an denen gewisse Theile durch das
Sieden von Fluͤssigkeiten, und auch durch die damit verbundene Ausdehnung der
Luft in Bewegung gesezt werden.
Die solcher Weise erzeugte Bewegung dient zum Schließen oder Oeffnen von Oeffnungen,
damit man hiedurch den Ein- oder Austritt des Luftzuges in den Oefen der
Kessel absperren oder eroͤffnen kann. Bei der Anwendung der erwaͤhnten
Verbesserungen an jenen Kesseln, in welchen Wasser zum Kuͤchengebrauche
gekocht werden soll, wirkt das Aufsieden des Wassers oder der sonstigen
Fluͤssigkeit direct auf Schwimmer, die solcher Maßen mit dem Rauchfange des
zum Kessel gehoͤrigen Ofens verbunden sind, daß sie beim Emporsteigen den
Luftzug absperren, waͤhrend sie ihn beim Herabsinken wieder eroͤffnen.
An jenen Apparaten hingegen, an denen meine Verbesserungen zur Regulirung der
Temperatur in Kesseln, in welchen das Wasser nicht zum Sieden zu kommen braucht, wie
z.B. in den Kesseln zum Hizen von Baͤdern, dienen sollen, so wie auch bei der
Benuzung meiner Verbesserungen zur Regulirung der Temperatur in Werkstaͤtten,
Treibhaͤusern, Stubenoͤfen, muß der Apparat so gebaut seyn, daß er
durch die Ausdehnung der Luft wirkt; oder daß er eine Fluͤssigkeit
enthaͤlt, welche bei jener Temperatur siedet, die gleichfoͤrmig
unterhalten werden soll, und die uͤber oder unter 212° F. (80°
R.) betragen kann. Der Apparat oder ein Theil desselben wird in dem Kessel oder Ofen
in der Werkstaͤtte oder in dem sonstigen Gebaͤude angebracht, so
daß sich die Temperatur an die in dem Apparate enthaltene Fluͤssigkeit
fortpflanzt, und sie zum Sieden und zur Entwiklung von Dampf bringt, sobald diese
Temperatur den gewuͤnschten Grad uͤbersteigt. Das Aufsieden der
Fluͤssigkeit sezt, wie ich weiter unten zeigen werde, den Apparat oder einen
Theil desselben in Bewegung, und diese Bewegung kann dann an einen in dem Feuerzuge
angebrachten Daͤmpfer oder an ein sogenanntes Register fortgepflanzt werden,
wodurch entweder der Eintritt von kalter Luft abgeschnitten, oder das Entweichen von
heißer Luft gestattet wird. Die beigefuͤgten Zeichnungen werden dieß deutlich
machen.
Fig. 15 bis
20 zeigen
einen vollstaͤndigen Kochapparat mit einem Ofen und einem Kessel, der mit
meinen Verbesserungen ausgestattet ist.
Fig. 21 und
22 zeigen
einen anderen Kochapparat, an dessen Kessel die Regulirvorrichtung angebracht
ist.
Fig. 23 und
24 zeigen
einen Apparat, der in einem Gebaͤude angebracht, oder mit einem Kessel in
Verbindung gesezt werden kann.
Fig. 25 zeigt
einen nach meiner Erfindung erbauten Apparat, welcher hauptsaͤchlich zur
Regulirung der Temperatur eines Gebaͤutes oder eines Gemaches, in welchem ein
Wechsel der Temperatur erforderlich ist, wie z.B. eines Treibhauses oder einer
Werkstaͤtte bestimmt ist.
In Fig. 15 und
16, wovon
erstere einen Durchschnitt und leztere einen Grundriß eines Kochkessels und Ofens
mit einem zur Regulirung dienenden Schwimmer darstellt, ist A, A der Kessel, in dessen einer Haͤlfte ein cylindrisches, als
Feuerstelle oder Ofen dienendes Gefaͤß B, B
angebracht ist. In das obere Ende dieses Gefaͤßes sind Loͤcher
geschnitten, durch welche die Luft, die zur Unterhaltung der Verbrennung diente,
austritt. Auf dem Roste C, der im Grunde des Ofens auf
Fuͤßen steht, und den man im Grundrisse Fig. 16 deutlich sieht,
wird ein Holzkohlenfeuer angemacht. Aus dem unteren Theile des Ofens begibt sich
eine Kammer D heraus, aus welcher eine Roͤhre E emporsteigt; diese sieht man auch aus Fig. 17, wo sie zugleich
mit dem zur Regulirung dienenden Schwimmer im Durchschnitte dargestellt ist. Rund um
den oberen Theil dieser Roͤhre sind Loͤcher geschnitten, durch welche
die aͤußere Luft eindringt; diese Luft gelangt naͤmlich durch den
Canal D in den Ofen, steigt durch das auf dem Roste
befindliche Brennmaterial empor, und tritt an dem oberen Ende des Ofens B aus, so daß hiedurch ein gehoͤriger Luftzug
unterhalten wird. F ist eine Roͤhre, welche lose
an die Roͤhre E gepaßt ist, und an deren Ende ein umgekehrter, auf der
Kammer D aufruhender Napf G
geloͤthet ist; der obere Theil der Roͤhre F reicht bis dicht an die Luftloͤcher der Roͤhre E empor, ohne dieselben jedoch zu bedeken.
Dieser Apparat arbeitet auf folgende Weise. Nachdem das Feuer angezuͤndet ist,
wird der Kessel beinahe mit Wasser gefuͤllt, so daß es den Ofen und die
Roͤhre F umgibt, waͤhrend es uͤber
den umgekehrten Napf oder Schwimmer G emporsteigt. Die
in demselben enthaltene Luft wird, so wie das Wasser steigt, ausgetrieben, indem sie
aus dem oberen Theile des Napfes durch eine kleine Steigroͤhre h emporsteigt. Diese Roͤhre h wird, sobald der Kessel gehoͤrig
gefuͤllt ist, an ihrem oberen Ende mit einem genau in dieselbe passenden
kegelfoͤrmigen Pfropfe c verschlossen, wo dann
das Wasser in der Roͤhre h auf derselben
Hoͤhe steht, wie in dem uͤbrigen Kessel. Hierauf wird uͤber den
Ofen ein Dekel gebracht; der Dekel d, d, der an den Ofen
B, B geloͤthet ist, und auf die eine
Haͤlfte des Kessels paßt, wird naͤmlich durch kleine Schieberzapfen
e, welche in die Seitenwaͤnde des Kessels
eindringen, fest herabgehalten, waͤhrend auf die andere Haͤlfte des
Kessels bei f, f gleichfalls ein anderer Dekel gebracht
wird. Eben so wird uͤber die Oeffnung, welche in dem Dekel d, d zum Herausnehmen und Einsezen des Regulirschwimmers
G bestimmt ist, ein kleiner Dekel gebracht. Diese
Dekel sollen so genau an einander passen, daß sie das freie Entweichen von Dampf
verhindern, womit jedoch nicht gemeint ist, daß sie einem starken Dampfdruke zu
widerstehen haben. Wenn Fleisch, Gemuͤse oder andere dergleichen Dinge im
Wasser gekocht werden sollen, so wird eine durchloͤcherte Platte H der Quere nach in den Kessel gebracht, damit diese
Substanzen nicht auf den Schwimmer G druͤken, und
dadurch dessen Spiel beeintraͤchtigen koͤnnen. Diese Platte H laͤßt sich, wie Fig. 15 und 16 zeigen, in
Falzen auf und nieder schieben, und das Wasser kann frei durch dieselbe circuliren.
So wie nun das Wasser zu sieden und Dampf zu entwikeln beginnt, so wird diese sowohl
in der Roͤhre h, als in dem Koͤrper des
Kessels emporsteigen, und indem er nicht so schnell, als er erzeugt wird, aus dem
Kessel entweichen kann, sich in dem oberen Theile der Roͤhre h ansammeln, und durch seine Ruͤkwirkung auf die
Wasserflaͤche auf den Pfropf dieser Roͤhre druͤken; oder wenn
Luft in der Roͤhre enthalten seyn sollte, diese comprimiren, und den
Schwimmer G emporluͤpfen. Der obere Theil der
Roͤhre F hingegen wird bei seinem Emporsteigen je
nach dem Raume, durch welchen er sich bewegt, die Zugloͤcher in der
Roͤhre E ganz oder zum Theil verschließen,
wodurch der Zug im Ofen ganz oder zum Theil aufgehoben, und folglich die Hize augenbliklich so
vermindert wird, daß in dem Kessel in kurzer Zeit kein Dampf mehr erzeugt wird. Da
der obere Theil des Regulators G, h nunmehr nicht mit
elastischem Dampfe erfuͤllt ist, so wird er wieder in seine fruͤhere
Stellung herabsinken, so daß die Zugloͤcher der Roͤhre E dadurch wieder frei werden; dadurch wird dann der Zug
sogleich wieder erneuert, und die Hize folglich wieder so gesteigert werden, daß
sich abermals Dampf in dem Kessel entwikelt; und so oft sich auf diese Weise je eine
etwas bedeutende Menge Dampf im Kessel entwikelt, wird der Regulirschwimmer G, h jedes Mal die hier beschriebene Wirkung
hervorbringen, und den Luftzug absperren. Die Theile, aus denen der Regulator
besteht, werden demnach verhindern, daß die Hize des Feuers das Wasser oder die
sonstige Fluͤssigkeit uͤber den Siedepunkt erhizt: d.h., sie werden
hindern, daß die Fluͤssigkeit nicht zu rasch aufsiedet oder
uͤberwallt, so daß das Fleisch oder die sonstigen zu siedenden Substanzen
gehoͤrig gekocht werden, ohne daß Jemand Acht darauf zu geben braucht. Um
einen vollstaͤndigen Kochapparat zu Stande zu bringen, sind mit dem Kessel
mehrere Kochgeschirre verbunden, die ich hier kurz beschreiben will, obschon
dieselben keinen Theil meiner Erfindungen ausmachen, die, wie gesagt, lediglich in
den hier beschriebenen Apparaten bestehen.
Man sieht einen ganzen derlei Kochapparat in Fig. 18 von Außen
abgebildet.
I in Fig. 19 ist ein
Gefaͤß, welches zum Behufe des Bratens und Bakens von Fleisch uͤber
dem Ofen B angebracht werden kann, indem der
cylindrische Hals l auf die Muͤndung des Ofens
paßt. Die in dem Ofen erhizte Luft geht durch einen Canal oder durch die Bratpfanne
i, und durch Loͤcher, welche in dem Boden des
Gefaͤßes, in welches das Fleisch gelegt wird, angebracht sind, so wie auch
durch einen Canal, der bei m durch punktirte Linien
angedeutet ist; sie geht also uͤber und unter dem Fleische, welches gebraten
werden soll, weg, und entweicht bei der in dem Dekel des Gefaͤßes
angebrachten Oeffnung n. J, L sind zwei Gefaͤße,
welche zum Daͤmpfen von Gemuͤsen dienen, und welche entweder
gemeinschaftlich oder einzeln angewendet werden koͤnnen; bedient man sich
beider, so bildet das obere den Dekel fuͤr das untere. Der Dampf steigt aus
den Kessel durch eine Roͤhre in das untere, und aus diesem durch eine andere
Roͤhre in das obere Gefaͤß empor. M ist
eine Schmorpfanne, welche auch statt des Rost- oder Bratgefaͤßes I uͤber dem Ofen angebracht werden kann, und N in Fig. 20 ist ein Kessel,
der zum Behufe des Siedens von Wasser uͤber dem Ofen gebracht werden kann,
wenn man dessen nicht zu anderen Zweken bedarf.
Die in Fig. 21
und 22
abgebildeten Apparate sind in ihren Leistungen den eben beschriebenen so
aͤhnlich, daß ich deren Einrichtung nur anzudeuten brauche. Der Ofen B befindet sich naͤmlich hier in einem zweiten
oder weiteren Cylinder oder Gehaͤuse A, A, und
der zwischen beiden leer bleibende ringfoͤrmige Raum dient als Reservekessel
zum Erhizen von Spuͤlwasser. D ist eine aus dem
Grundrisse Fig.
21 ersichtliche, an der Seite des Ofens befindliche Roͤhre, welche
sich unter dem Roste C in den Ofen oͤffnet. Durch
diese Roͤhre D tritt der zur Unterhaltung der
Verbrennung dienende Luftstrom ein, um dann durch das auf den Rost C gelegte Brennmaterial emporzusteigen, und endlich
durch den Rauchfang E zu entweichen, wozu an dem oberen
Theile dieses lezteren ein Loch a ausgeschnitten ist.
G ist der Kessel, der aus einem cylindrischen, in
den Ofen eingesezten Gefaͤße besteht, welches auf einem rund um den oberen
Theil desselben angebrachten Lager ruht. H ist der
umgekehrte Napf oder der Regulirschwimmer, der zum Behufe des Austrittes der Luft
beim Fuͤllen des Kessels mit einer kleinen Roͤhre J versehen ist. An dem Regulirschwimmer ist bei I mittelst eines Stieles ein Ring oder ein
Roͤhrenstuͤk angebracht, welches den Rauchfang genau unter dem offenen
Theile a desselben umgibt. Dieser Apparat arbeitet ganz
auf dieselbe Weise, wie der oben beschriebene, und die dort gegebenen Anweisungen,
wie man sich seiner zu bedienen hat, gelten auch hier.
Wenn also das Wasser oder die Suppe in dem Kessel die Siedehize erlangt haben, und
eine Quantitaͤt Dampf erzeugt worden ist, so steigt der Regulirschwimmer H wegen des Drukes des Dampfes in dem oberen Theile des
Schwimmers und seiner Roͤhre J empor, wo dann der
Ring oder die Roͤhre I die in dem Rauchfange E angebrachte Oeffnung zum Theil oder ganz verschließt.
Dadurch wird der Luftzug im Ofen unterbrochen und die Hize vermindert, so daß das
Sieden im Kessel nachlaͤßt, und daß also das Zugloch in dem Rauchfange E wieder geoͤffnet wird, wodurch die in dem
Kessel enthaltene Fluͤssigkeit verhindert wird uͤberzulaufen, ohne daß
irgend eine Beaufsichtigung noͤthig waͤre. K ist die in den Kessel gebrachte Platte, wodurch die Eßwaaren gehindert
werden, mit dem Regulator in Beruͤhrung zu kommen. L ist ein zum Daͤmpfen dienendes Gefaͤß mit einer
Roͤhre M, durch welche der Dampf aus dem Kessel
zum Behufe des Daͤmpfens der Gemuͤse eingelassen wird. Man kann,
gleichwie in Fig.
15 und 16, uͤber dieses auch noch ein anderes aͤhnliches
Gefaͤß stellen.
Fig. 23 zeigt
einen Apparat zum Reguliren der Temperatur eines Kessels, in welchem Wasser
fuͤr Baͤder gehizt wird, oder der zum Heizen eines Treibhauses
oder einer Werkstaͤtte dient. Diese Vorrichtung besteht naͤmlich aus
einer gebogenen oder Heberroͤhre H, G, deren
kuͤrzerer Schenkel sich mit einer weiten Muͤndung bei A gegen die atmosphaͤrische Luft oͤffnet,
waͤhrend sich der laͤngere Schenkel in eine Kugel B endigt. Die Kugel B, so
wie die gebogene Roͤhre werden mit einer Fluͤssigkeit, z.B. Wasser,
gefuͤllt, bis dieselbe in dem Schenkel H auf
einer bestimmten Hoͤhe steht, waͤhrend die Luft beim Fuͤllen
des Apparates aus der Stelle getrieben wird. C ist ein
Schwimmer, welcher zum Theil in die in dem Schenkel H
enthaltene Fluͤssigkeit untertaucht; er ist an einer Kette oder Schnur
aufgehaͤngt, welche uͤber die beiden Rollen 1 und 2 laͤuft, und
welche, wenn der Apparat an einem Kessel angebracht ist, mit dem anderen Ende an dem
Daͤmpfer oder Register in dem Feuerzuge befestigt wird, waͤhrend man
sie, wenn die Vorrichtung an einem Ofen oder in einem Gebaͤude angebracht
werden soll, mit einem Ventile, einem Fenster oder einer Fallthuͤre in
Verbindung bringt. Bevor man sich eines Apparates dieser Art bedient, muß man durch
Versuche ermitteln, bei welcher Temperatur die in ihm enthaltene Fluͤssigkeit
zum Sieden kommt; und wenn dieß geschehen ist, so muß der ganze Apparat, oder
wenigstens der obere Theil des Schenkels G und die Kugel
B der Temperatur jenes Ortes ausgesezt werden,
dessen Temperatur man reguliren will. So oft nun diese Temperatur uͤber den
Siedepunkt der in dem Apparate enthaltenen Fluͤssigkeit steigt, wird in der
Kugel B Dampf erzeugt werden, und dieser Dampf wird dann
auf die Oberflaͤche der Fluͤssigkeit druͤken; die Folge hievon
wird seyn, daß die Fluͤssigkeit in dem Schenkel H
emporsteigt, daß mithin auch der Schwimmer C steigt, und
daß der Daͤmpfer dafuͤr herabsinken, und den Feuerzug des Ofens mithin
ganz oder zum Theil verschließen wird. Soll der Apparat hingegen dadurch wirken, daß
man aus dem Orte, an welchem er sich befindet, heiße Luft austreten laͤßt:
d.h., ist er z.B. im Inneren eines Treibhauses angebracht, so muß die emporsteigende
Bewegung des Schwimmers so fortgepflanzt werden, daß dadurch, so oft die Temperatur
zu hoch steigt, ein Ventil oder ein Fenster oder eine Thuͤr geoͤffnet
wird. Damit einer und derselbe Apparat auch als Regulator fuͤr verschiedene
Temperaturen angewendet werden koͤnne, kann man verschiedene, bei
verschiedenen Temperaturen siedende Fluͤssigkeiten in denselben bringen:
naͤmlich fuͤr Temperaturen uͤber 212° F. oder 80°
R. Aufloͤsungen von Kochsalz, salzsaurem Kalk oder Schwefelsaͤure in
Wasser, in welchen Aufloͤsungen der Salz- oder Saͤuregehalt je
nach der Temperatur, bei der sie sieden sollen, verschieden abgeaͤndert wird;
fuͤr Temperaturen unter 212° F. hingegen andere, bei niedrigen Temperaturen siedende
Fluͤssigkeiten, wie z.B. Alkohol, oder Aether fuͤr sich oder in
Verbindung mit anderen Substanzen. Man hat hiebei, wie schon oben gesagt worden ist,
nur durch sorgfaͤltige und genaue Versuche vorher zu bestimmen, bei welchem
Hizgrade die in den Apparat gebrachte Fluͤssigkeit siedet. Dieß kann auf die
aus Fig. 24
ersichtliche Weise geschehen, indem hier die Regulirfluͤssigkeit, anstatt
direct mit dem Schwimmer C zu communiciren, mittelst
einer Queksilbersaͤule auf denselben wirkt. Je nach dem Unterschiede, der
zwischen der Hoͤhe der Queksilbersaͤule in dem Schenkel G und jener in dem Schenkel H Statt findet, kann der Druk auf die in der Kugel B befindliche Regulirfluͤssigkeit vermindert oder verstaͤrkt
werden; und da nun die Fluͤssigkeiten unter verschiedenem Druke auch bei
verschiedener Temperatur sieden, so kann man eine und dieselbe Fluͤssigkeit,
wie z.B. Wasser, auch zu einem Regulator fuͤr verschiedene Temperaturen
machen, je nachdem man das Verhaͤltniß zwischen den Hoͤhen der
Queksilbersaͤulen in G und H abaͤndert.
Fig. 25 gibt
eine Ansicht eines Apparates, welcher speciell dazu bestimmt ist, die Luft eines
Ofens oder eines Treibhauses, oder einer Werkstaͤtte so zu reguliren, daß sie
eine bestimmte gegebene Temperatur hat. Auch dieser Apparat wirkt gleich den
vorhergehenden durch das Sieden einer Fluͤssigkeit; nur wirkt das Aufsieden
hier direct auf das Instrument selbst, und die Bewegung des Instrumentes wird dann
ohne Dazwischenkunft eines Schwimmers an den Daͤmpfer, oder an das Ventil,
oder an das Register fortgepflanzt. Er besteht naͤmlich aus einer sich
schwingenden oder oscillirenden Roͤhre A, A, an
deren beiden Enden sich eine Kugel befindet, und welche so mit Queksilber
gefuͤllt ist, daß die Kugel C zu 2/3 die Kugel
B hingegen nur zu 1/3 damit angefuͤllt ist.
Das uͤbrige Drittheil der Kugel C enthaͤlt
die Regulirfluͤssigkeit, welche hier z.B. aus Wasser bestehen soll; sie wird,
nachdem der Apparat gefuͤllt, und die Luft aus ihr ausgetrieben worden ist,
mittelst des Stoͤpsels a fest verschlossen,
waͤhrend man die Kugel B dem Zutritte der Luft
offen laͤßt. Die Roͤhre A, A wird von
einer Scheide oder Schraubenklammer D, in der sie sich
ruͤk- und vorwaͤrts bewegen kann, und in der sie sich durch die
Schraube E an einer beliebigen Stelle fixiren
laͤßt, getragen. Die Scheide D ist mittelst ein
Paar Gelenkstuͤken F, die an dem Kloben G fixirt sind, an einem Zapfen aufgehaͤngt. H ist eine Schieberscheide, an der mittelst einer Kette
oder Schnur 2 der Daͤmpfer oder das Register aufgehaͤngt ist; soll die
Bewegung des Apparates hingegen eine Oeffnung aufmachen oder schließen, so muß die
Kette je nach Umstaͤnden mit einem Ventile, einem Fenster oder einer
Thuͤre in Verbindung gebracht werden. Die Scheide H kann an irgend einem Theile der Roͤhre A,
A mittelst der Schraube I befestigt werden. L, L ist ein Maßstab, der je nach den verschiedenen
Temperaturen, bei denen eine bestimmte Fluͤssigkeit unter verschiedenem Druke
der Luft siedet, und mit Bezug auf die Unterschiede in der Hoͤhe des
Queksilberstandes in den beiden Kugeln B und C, welche durch Umdrehen der Roͤhre A, A um ihren Zapfen oder um den Mittelpunkt ihrer
Bewegung hervorgebracht werden, in Grade eingetheilt ist. Denn es ist klar, daß je
mehr man die Roͤhre A in eine der senkrechten
gleichkommende Linie bringt, um so hoͤher die Queksilbersaͤule seyn
muß, welche bei d auf die Fluͤssigkeit
druͤkt, und umgekehrt. Je nachdem man hingegen die Roͤhre in der
Scheide D ruͤk- oder vorwaͤrts
schiebt, und je nachdem man ein Gleiches auch mit der Scheide H thut, koͤnnen die beiden Arme der Roͤhre A mit einander im Gleichgewichte erhalten werden, wenn
auch der Druk auf die Fluͤssigkeit d verschieden
ist. An der Roͤhre A ist unter der Kugel C ein Zeiger K angebracht.
Da die Grade an der Scala nach Versuchen so verzeichnet sind, daß sie andeuten,
welcher Druk auf die Fluͤssigkeit d bei jeder
verschiedenen Neigung, welche man der Roͤhre A
gibt, ausgeuͤbt wird; und da jeder Grad mit jener Temperatur bezeichnet ist,
bei der die Fluͤssigkeit unter einem solchen Druke siedet, so wird man
folgendes Spiel des Apparates leicht verstehen. Um den Apparat so anzubringen, daß
er irgend eine in seinem Bereiche liegende Temperatur gehoͤrig regulirt,
braucht man nichts weiter, als die Roͤhre A so
weit um den Mittelpunkt ihrer Bewegung zu drehen, daß deren Zeiger auf jenen Grad
der Scala zeigt, der diese Temperatur andeutet, und sie dann in der einen oder in
der anderen Richtung so weit in ihrer Scheide zu bewegen, daß ihre beiden Arme
einander das Gleichgewicht halten, oder daß das Ende C
nur ein unbedeutendes Uebergewicht behauptet. Hierauf werden die beiden Schrauben
E und I festgestellt,
und in eines der Loͤcher, die sich in der Scala befinden, unter das Ende der
Roͤhre und zur Unterstuͤzung derselben ein Stift gestekt. Die
Fluͤssigkeit d wird sich demnach unter diesen
Umstaͤnden unter dem Druke einer Queksilbersaͤule befinden, bei
welchem sie bei jener Temperatur siedet, auf die der Zeiger K deutet. So wie daher die Temperatur des Ortes, an welchem sich der
Apparat befindet, jene Temperatur, auf welche der Zeiger deutet, uͤbersteigt,
so wird die Fluͤssigkeit bei d zu sieden
beginnen, und der hiedurch entwikelte Dampf, indem er auf die Oberflaͤche des
Queksilbers in C wirkt, dieses Queksilber in die Kugel
B emportreiben. Die Folge hievon wird seyn, daß
dieser Arm der Roͤhre A nunmehr das Uebergewicht
bekommt, herabsinkt,
die Kette 2 mit sich zieht, und auf einen Daͤmpfer oder auf ein Ventil wirkt,
wodurch die Temperatur entweder durch Beschraͤnkung des Luftzuges im Ofen,
oder dadurch vermindert wird, daß man die heiße Luft entweichen und kuͤhle
dafuͤr eintreten laͤßt. So wie nun die Hize aufhoͤrt, wird auch
das Sieden der Fluͤssigkeit d aufhoͤren,
und das Queksilber aus B auf seine fruͤhere
Hoͤhe in der Kugel C zuruͤkfließen;
hieraus wird folgen, daß diese Kugel wieder herabsinkt, und daß die Kette 2 wieder
emporgehoben wird, und den fruͤheren Luftzug herstellt, so daß die Temperatur
solcher Maßen bestaͤndig gleich erhalten wird. Anstatt die Roͤhre in
den beiden Scheiden D und H
beweglich zu machen, kann sie uͤbrigens auch darin fixirt werden, wo dann ein
Ring, der sich zwischen D und der Kugel C an der Roͤhre schiebt, hinreichen
wuͤrde, um den entgegengesezten Arm in jeder beliebigen schiefen Stellung des
Apparates so zu balanciren, daß das Ende C eben auf den
Stift, den man in irgend eine der Eintheilungen der Scala stekte,
herabgedruͤkt wird: waͤhrend dennoch eine sehr geringe Kraft
hinreicht, um den Apparat um den Mittelpunkt seiner Bewegung zu drehen. Zu bemerken
ist, daß man auch an den unter Fig. 23 und 24
beschriebenen Apparaten eine dieser aͤhnliche Scala anbringen kann, wo ein
jeder Grad dem Druke entsprechen muͤßte, der auf die
Regulirfluͤssigkeit in B ausgeuͤbt wird,
wenn die Queksilbersaͤule in H auf einer
bestimmten Hoͤhe steht; und wo ein jeder Grad mit jener Temperatur bezeichnet
waͤre, bei welcher die Fluͤssigkeit unter diesem Druke siedet.
Die Ausdehnung der Anwendbarkeit irgend eines dieser Apparate, wenn derselbe durch
Abaͤnderung des Drukes auf die Regulirfluͤssigkeit wirken soll, wird
von der Hoͤhe der Queksilbersaͤulen, deren man sich bedient,
abhaͤngen. Wenn die Saͤule in dem Schenkel G, Fig.
24, hoch genug ist, um dem Druke der Atmosphaͤre auf die
Oberflaͤche des Queksilbers in dem Schenkel H
(wie dieß in einem Barometer der Fall ist) das Gleichgewicht zu halten, so wird die
Fluͤssigkeit bei B im luftleeren Raume sieden;
und vergroͤßert man die Hoͤhe der Queksilbersaͤule in H, so kann der Druk auf die Fluͤssigkeit bis zum
atmosphaͤrischen Druke oder daruͤber erhoͤht werden. Die
Laͤnge der Schenkel H und G muß sich daher danach richten, ob der Apparat bei Temperaturen, welche
unter oder uͤber 212° F. betragen, angewendet wird. Eben so ist der
Spielraum oder die Anwendbarkeit des in Fig. 25 abgebildeten
Apparates durch die Hoͤhe der Queksilbersaͤule, die man bei einer
geeigneten Neigung des Apparates erhalten kann, bedingt, und folglich von der
Laͤnge des Radius seiner Arme abhaͤngig.
Man kann an meinen verbesserten Apparaten auch die Elasticitaͤt der
atmosphaͤrischen Luft in Anwendung bringen, und zu diesem Behufe etwas
atmosphaͤrische Luft zugleich mit der Regulirfluͤssigkeit in denselben
schaffen. An den Apparaten Fig. 23, 24 und 25 geschieht dieß, indem
man die Luft mit der Fluͤssigkeit in die Kugeln B
oder C treten laͤßt; an den Kochapparaten Fig. 15 bis
20, und
Fig. 21
und 22, indem
man dadurch, daß man beim Fuͤllen des Kessels die Stoͤpsel
verschließt, etwas Luft in den Roͤhren h und J zuruͤkhaͤlt. Die Ausdehnung der in den
Kugeln oder in dem umgekehrten Napfe enthaltenen Luft, welche beim Erhizen derselben
eintritt, wird eben so wie der durch das Sieden der Fluͤssigkeit erzeugte
Dampf die Schwimmer heben, oder den in Fig. 25 abgebildeten
Apparat um den Mittelpunkt seiner Bewegung drehen.
In einigen Faͤllen duͤrfte sogar ein Apparat, der bloß durch die
Ausdehnung der Luft wirkt, vortheilhafter seyn. Eines solchen Apparates bediene ich
mich z.B. zur Regulirung der Temperatur eines Ofens zum kuͤnstlichen
Ausbruͤten der Eier, wozu eine Waͤrme von beilaͤufig 32°
R. oder 72° F. erforderlich ist. Ich wende hiezu einen aus Fig. 26 ersichtlichen
Regulirschwimmer an, der nach Art der an den Kochapparaten beschriebenen Schwimmer
gebaut ist, und den man in ein mit Wasser gefuͤlltes Gefaͤß
untertaucht, waͤhrend man den oberen Theil des umgekehrten Napfes a mit Luft gefuͤllt laͤßt. Dieser
Regulirapparat wird entweder in den Ofen oder sonst an eine Stelle gebracht, an der
er der Temperatur desselben theilhaftig wird. Die in dem oberen Theile des
Schwimmers a enthaltene Luft dehnt sich aus, so wie die
Luft und das Wasser, die ihn umgeben, erhizt werden; und der Schwimmer ist so
eingerichtet, daß er, wie ich dieß bei Fig. 15 gezeigt habe, den
Luftzug im Ofen absperrt, sobald die Luft in dem Ofen, oder die auch dem Ofen
kommende, und den Apparat umgebende Luft eine Temperatur von 32° R.
uͤbersteigt. Ein Regulirapparat dieser Art kann auf die Roͤhre eines
Daͤmpfers wirken und dadurch den Rauchfang des Ofens auf die bei dem oben
beschriebenen Kochapparate ersichtliche Weise schließen: oder dieß kann, je nachdem
es die Umstaͤnde erfordern, auch durch einen an einer Kette
aufgehaͤngten Daͤmpfer geschehen. Die Anpassung eines solchen
Apparates zu dem bestimmten Zweke geschieht jedoch durch Abaͤnderung der
Laͤnge der Daͤmpferroͤhre oder der Laͤnge der Kette, an
welcher der Daͤmpfer aufgehaͤngt ist; denn der Schwimmer wird, sobald
die Luft erhizt zu werden anfaͤngt, steigen oder sich etwas bewegen, und die
Laͤnge der Roͤhre des Daͤmpfers, welcher den Rauchfang
verschließt, oder die Laͤnge der Kette, an der der Daͤmpfer
aufgehaͤngt ist, muß eine solche seyn, daß das Emporsteigen des Schwimmers den Luftzug nicht eher
abzusperren beginnt, als bis die Hize des Ofens den gewuͤnschten
Temperaturgrad uͤbersteigt. Der Schwimmer muß daher nach Versuchen
eingerichtet werden, so oft man den Ofen durch ihn auf einer anderen Temperatur als
der gewoͤhnlich gebraͤuchlichen erhalten will. Ebendiese Anweisungen
darf man auch nicht unberuͤksichtigt lassen, so oft man einen der
beschriebenen Apparate durch die Ausdehnung der Luft wirken lassen will, d.h. die
Laͤnge der Daͤmpferroͤhren oder die Laͤnge der Ketten
der Daͤmpfer muß eine solche seyn, daß fuͤr die Bewegung, welche durch
die Ausdehnung der Luft entsteht, bevor der Kessel, der Ofen oder der sonstige zu
regulirende Ort noch die erforderliche Temperatur erreicht hat, gehoͤriger
Spielraum bleibt. In Hinsicht auf die Anwendung der Ausdehnung der Luft ist zu
bemerken, daß die Expansivkraft, welche die Luft bei geringer Erhoͤhung der
Waͤrme besizt, sehr gering ist, und daß dieselbe also nicht ausreicht, wenn
zur Ueberwindung des Widerstandes des Daͤmpfers oder des Ventiles eine etwas
bedeutende Kraft erforderlich ist. Auch entwikelt und vermindert sich die durch die
Ausdehnung der Luft entstehende Kraft nur langsam und allmaͤhlich,
waͤhrend die durch das Aufsieden von Fluͤssigkeiten bedingte Kraft
sich, wie gesagt, nicht fruͤher als zu einer bestimmten Zeit aͤußert,
und dann rasch in Wirksamkeit tritt, um eben so schnell wieder außer Wirksamkeit zu
kommen. Es muß daher dem Fabrikanten uͤberlassen bleiben, die besonderen
Umstaͤnde zu erwaͤgen, unter denen es vortheilhafter seyn
duͤrfte, den Apparat durch die Ausdehnung der Luft arbeiten zu machen.
Es ist unmoͤglich, in Hinsicht auf die Anwendung der von mir hier
beschriebenen Verbesserungen und Apparate mehr als allgemeine Regeln anzugeben; denn
die Verhaͤltnisse und die Zusammenstellung der einzelnen Theile
muͤssen je nach den Umstaͤnden und den Zweken, zu denen die Apparate
dienen sollen, verschieden abgeaͤndert werden. Der Verfertiger derselben muß
daher zu waͤhlen wissen, welche Vorrichtung einem einzelnen Falle am besten
entspricht; er muß zu waͤhlen wissen, ob er diese oder jene
Regulirfluͤssigkeit anzuwenden hat, oder wie er bei Anwendung einer und
derselben Fluͤssigkeit den Druk auf dieselbe durch Vermittelung einer
Saͤule einer anderen Fluͤssigkeit abzuaͤndern hat; oder wie er
bei Benuzung der Ausdehnung der Luft zu verfahren hat. Unter allen Umstaͤnden
muß jeder der Apparate, bevor man ihn errichtet, durch Versuche erprobt werden, ob
er das leistet, was er leisten soll; besonders muß dieß geschehen, wenn derselbe
Apparat zur Regulirung verschiedener Temperaturen durch verschiedenen, auf die
Fluͤssigkeiten wirkenden Druk dienen soll; und wenn eine Scala an demselben
angebracht ist, so muß diese jedes Mal nach Versuchen graduirt werden, und zwar
fuͤr jeden einzelnen Apparat, und mit Bezug auf die Grade des Drukes, unter
denen die angewendete Regulirfluͤssigkeit bei den verschiedenen Temperaturen,
auf denen sie den Kessel, den Ofen, das Gebaͤude etc. erhalten soll, siedet.
Hat dieß der Fabrikant ein Mal gethan, so braucht derjenige, der sich des Apparates
spaͤter bedienen will, nur mehr die oben angedeuteten allgemeinen
Verhaltungsmaßregeln zu befolgen. Soll die Temperatur eines gegebenen Ortes sehr
genau regulirt werden, so soll derselbe nicht unmittelbar und direct durch den Ofen
geheizt werden, sondern durch Vermittelung einer Masse heißen Wassers, Dampfes oder
heißer Luft; denn der Ofen kann eine große Quantitaͤt Hize ansammeln, so daß
er selbst lange, nachdem der Regulator den Feuerzug bereits verschlossen, doch noch
den Ort, dessen Temperatur auf einem bestimmten Punkte erhallen werden soll, zu
heizen fortfaͤhrt. In diesem Falle sollte dann der Regulator nicht direct auf
den Kessel oder auf den sonstigen Ort, dessen Hize gleichmaͤßig unterhalten
werden soll, wirken, sondern man muͤßte ihn auf die zur Vermittelung dienende
Masse Dampf, heißes Wasser oder heiße Luft wirken lassen: so daß auf diese Weise
jedes Mal, so oft die Temperatur zu hoch steigt, eine den Zufluß der heißen Luft,
des Dampfes oder des heißen Wassers absperrende Klappe geschlossen wird; und
umgekehrt, daß diese Klappe wieder geoͤffnet wird, sobald die Temperatur
wieder sinkt.
Tafeln