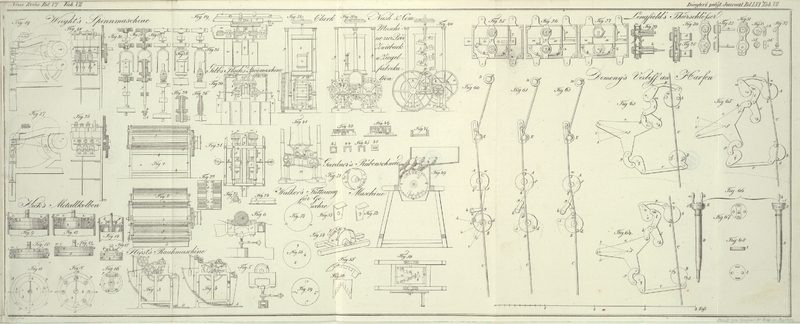| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Zerschneiden von Rüben, Runkelrüben oder anderen Wurzeln, deren man sich als Viehfutter bedient, worauf sich James Gardner, Eisenhändler von Banbury, in der Grafschaft Oxford, am 25. Septbr. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LXXVI., S. 429 |
| Download: | XML |
LXXVI.
Verbesserungen an den Maschinen zum Zerschneiden
von Ruͤben, Runkelruͤben oder anderen Wurzeln, deren man sich als
Viehfutter bedient, worauf sich James Gardner, Eisenhaͤndler von Banbury, in der Grafschaft
Oxford, am 25. Septbr. 1834 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. April 1835, S.
28.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Verbesserte Maschinen zum Zerschneiden von Ruͤben,
Runkelruͤben etc.
Fig. 49 zeigt
eine Maschine, an der das von dem Patenttraͤger erfundene kreisende
Schneidinstrument zum Behufe des Zerschneidens verschiedener Wurzeln angebracht ist;
die Seite des Gehaͤuses der Maschine, so wie auch der zur Speisung dienende
Trichter sind abgenommen, damit man die inneren Theile der Vorrichtung um so genauer
ersehen kann. Fig.
50 zeigt die Maschine von Oben, woraus die Einrichtung des kreisenden
Schneidinstrumentes noch deutlicher erhellt. Das Schneidinstrument ist
naͤmlich wie eine Trommel, die an einer Achse aufgezogen ist, geformt; nur
haben verschiedene Theile ihres Umfanges, wie man bei a,
a und b, b sieht, verschiedene Radien, damit
auf diese Weise Ausschnitte gebildet werden, in welche die Wurzeln hineinfallen,
bevor sie unter die Einwirkung der Schneidemesser gelangen.
Fig. 51 gibt
eine perspektivische Ansicht des gußeisernen Theiles der Trommel mit ihrer Achse,
bevor noch die Messer daran angebracht sind. Diese Messer sollen zwei unter rechten
Winkeln gegeneinander gestellte Schneiden haben; eine der besten Formen fuͤr
dieselben haͤlt der Patenttraͤger die in Fig. 52 abgebildete. Fig. 53 zeigt
ein aͤhnliches Messer, welches jedoch fuͤr die entgegengesezte Seite
der Trommel bestimmt ist. Seitlich an den Stufen der Trommel bei c, c, c wird, wie Fig. 49 zeigt, mit
Schrauben oder anderen Vorrichtungen eine Reihe der aus Fig. 52 ersichtlichen
Messer angebracht, und eine andere Reihe der aus Fig. 53 ersichtlichen
Messer wird auf aͤhnliche Weise an den Stufen d, d,
d der entgegengesezten Seite der Trommel befestigt. Die Stufen laufen mit
den Seiten der Trommel und mit einander selbst parallel; das lezte Messer der einen
Reihe, welches das mittlere Messer bildet, muß umgekehrt und an der mittleren Platte
der Trommel befestigt seyn.
Nachdem die Messer auf solche Weise befestigt worden sind, werden auch die gebogenen
Platten b, b mit Bolzen oder Schrauben an dem
gußeisernen Theile der Trommel fest gemacht, damit auf diese Weise die offenen
Theile der Trommel verschlossen, und die groͤßeren mit den gebogenen Theilen
der Messer zusammenfallenden Radien des Umfanges gebildet werden.
Das auf diese Weise zusammengesezte Schneidinstrument erscheint demnach im
Perspective, so wie es in Fig. 54 abgebildet ist.
So wie es sich um seine Achse dreht, kommen nach einander die Messer in
Thaͤtigkeit, wobei ihre oberen Schneiden saͤmmtlich in eine und
dieselbe cylindrische Curve zusammenfallen, waͤhrend sich ihre radialen
Schneiden in parallelen Kreisen unter rechten Winkeln mit der Achse der Trommel
umdrehen.
Wenn daher die Ruͤben oder die sonstigen zu zerschneidenden Wurzeln, wie Fig. 49 zeigt,
in den Trichter der Maschine gebracht werden, so fallen sie auf den Umfang der
Trommel hinab, welche, indem sie durch eine an ihrer Achse angebrachte Kurbel in
kreisende Bewegung versezt wird, die Messer nach einander in Thaͤtigkeit
bringt, und die Wurzeln in schmale Streifen zerschneidet. Diese Streifen oder
Stuͤke gelangen dann durch Oeffnungen, welche sich hinter den Messern
befinden, in das Innere der Trommel, aus welchem sie hierauf auf den Boden oder in
ein auf diesen gestelltes Gefaͤß fallen.
Bei dem beschriebenen Baue der Messer und bei der Art und Weise, sie an der Trommel
zu befestigen, kann jedes derselben im Falle eines Bruches leicht durch ein neues
ersezt werden. Man kann uͤbrigens die Messer auch solcher Maßen verfertigen,
daß man Stahlplatten in die aus Fig. 55 ersichtliche Form
biegt, wo dann die Schneiden dieselben Stellungen haben, wie an den eben
beschriebenen Messern. Wenn diese Platten an dem gußeisernen Theile der Trommel
befestigt sind, so bildet der gebogene Theil der Platten jenen Theil des Umfanges
der Trommel, der in der fruͤheren Abbildung mit b
bezeichnet ist.
Der Patenttraͤger beschraͤnkt sich uͤbrigens auf keine bestimmte
Anzahl von Messern, die er an den Trommeln anzubringen gedenkt; auch ist es nicht durchaus
nothwendig, daß immer zwei Reihen von Messern angebracht werden, wie dieß in den
fruͤheren Figuren gezeigt ist; eben so behaͤlt er sich es vor die
Messer auch von einem Ende zum anderen in einer diagonalen Reihe laͤngs der
Trommel anzubringen, wie man dieß sehen wuͤrde, wenn man die Trommel unter
rechten Winkeln mit ihrer Achse und nach der punktirten Linie, welche man aus Fig. 50
ersieht, in zwei gleiche Theile zerschneiden wuͤrde.
Schließlich erklaͤrt der Patenttraͤger, daß er die Befestigung seiner
eigenthuͤmlichen Messer mit zwei Schneiden auf die in den angezogenen Figuren
gezeigte Art und Weise, so wie auch die Stellung derselben in den beschriebenen
diagonalen Reihen, und jede andere Art von Messer, deren radiale
Schneidflaͤchen mit den Enden der Trommel und mit einander selbst parallel
laufen, als seine Erfindung in Anspruch nimmt. Ein Beispiel der Anordnung einer
Reihe gerader Messer in Verbindung mit einer diagonalen Schneide ersieht man aus
Fig.
56.
Tafeln