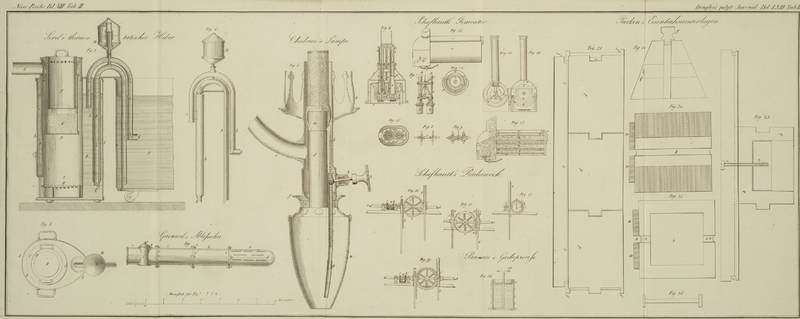| Titel: | Bericht des Hrn. Péclet über den thermostatischen Heber des Hrn. Sorel in Paris. |
| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. XX., S. 115 |
| Download: | XML |
XX.
Bericht des Hrn. Péclet uͤber den thermostatischen Heber des
Hrn. Sorel in
Paris.
Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement.
November 1836, S. 409.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Péclet's Bericht uͤber den Sorel's thermostatischen
Heber.
Hr. Sorel ist der Erfinder eines neuen Apparates, womit
man das Gleichgewicht zwischen den Temperaturen mehrerer in verschiedenen
Gefaͤßen enthaltenen Fluͤssigkeiten herstellen kann, oder, was auf
dasselbe hinausgeht, womit man die in mehreren Gefaͤßen enthaltenen
Fluͤssigkeiten erwaͤrmen kann, obschon man die Waͤrme nur auf
ein einziges dieser Gefaͤße einwirken laͤßt. Man erreichte diesen Zwek
bisher nur dadurch, daß man die oberen und unteren Theile dieser Gefaͤße durch
Roͤhren mit einander verband; Hrn. Sorel dagegen
gelang es eben dasselbe mittelst zweier beweglicher Heber zu bewerkstelligen.
Der sogenannte thermostatische Heber des Hrn. Sorel
besteht aus zwei Hebern, die miteinander ein Ganzes bilden, und welche
gemeinschaftlich angesaugt werden. Es geschieht dieß mit Huͤlfe eines mit
Wasser gefuͤllten Behaͤlters, der, was seine Gestalt und seine
Einrichtung betrifft, mit dem Oehlbehaͤlter jener Lampen
uͤbereinstimmt, in denen das Oehl bestaͤndig auf gleichem Niveau
erhalten wird, und die mit einem seitlichen Oehlbehaͤlter ausgestattet sind.
Dieser Behaͤlter wird an dem oberen Theile des einen der Heber angebracht; er
entleert sich augenbliklich, so wie er sich an Ort und Stelle befindet,
fuͤllt sich dafuͤr mit der Luft, die urspruͤnglich in den
beiden Hebern enthalten war, und bedingt dadurch die Ansaugung dieser lezteren. Die
beiden Heber tauchen gleich weit in das mit heißem Wasser gefuͤllte
Gefaͤß unter; ungleich ist deren Untertauchung hingegen in dem mit kaltem
Wasser gefuͤllten Gefaͤße. Aus dieser Ungleichheit geht hervor, daß
der minder tief untertauchende Heber das heiße Wasser aus ersterem Gefaͤße in
lezteres hinuͤber fuͤhrt, waͤhrend umgekehrt der andere Heber
das kalte Wasser aus lezterem Gefaͤße in ersteres verpflanzt. Betrachtet man
naͤmlich einen mit heißem Wasser gefuͤllten Heber, der einerseits in
ein mit heißem und andererseits in ein mit kaltem Wasser gefuͤlltes
Gefaͤß untertaucht, so werden sich nach hergestelltem Gleichgewichte die
Niveaus der Fluͤssigkeiten nicht in einer und derselben Flaͤche
befinden, indem auf jenen Theil des Heberarmes, der in das kalte Wasser untertaucht
und der mit heißem Wasser erfuͤllt ist, die ihn umgebende Fluͤssigkeit
mit einer Kraft druͤkt, die groͤßer ist als sein Gewicht, und indem
hieraus eine Kraft hervorgeht, welche das Gewicht der das Niveau
uͤbersteigenden heißen Wassersaͤule vermindert, so daß folglich das
Gleichgewicht nur in so fern bestehen kann, als diese heiße Wassersaͤule
groͤßer ist als jene, welche dem mit heißem Wasser gefuͤllten
Gefaͤße entspricht. Da aber dieser Unterschied im Niveau mit der
Laͤnge jenes Heberarmes, der in das mit kaltem Wasser gefuͤllte
Gefaͤß untertaucht, im Verhaͤltnisse steht, so koͤnnte bei zwei
Hebern, die in ungleicher Laͤnge in lezteres Gefaͤß untertauchen, das
Gleichgewicht gar nie bestehen; denn wenn der Unterschied der Niveaus groͤßer
oder kleiner ist, als die Differenz, welche einem jeden der Heber entspricht, so
wuͤrden beide Heber nach einer und derselben Richtung wirken; waͤhrend
sie, wenn diese Differenz zwischen den auf die beiden Heber bezuͤglichen
begriffen ist, nach entgegengesezten Richtungen wirken. An dem Sorel'schen Apparate ist das Spiel der Heber uͤberdieß durch
eine Roͤhre beguͤnstigt, welche mit Luft erfuͤllt ist, und
welche den in das heiße Wasser untertauchenden Arm jenes Hebers umgibt, der das
kalte Wasser in das Gefaͤß leitet, auf welches man die Waͤrme direct
wirken laͤßt. Diese Luftschichte erhoͤht offenbar die Geschwindigkeit
des Abflusses in diesem Heber, und mithin auch jene in dem anderen Heber, indem sie
der Erhizung des kalten Wassers in diesem Theile des Hebers vorbeugt.
Man hat sich dieses Apparates bereits mit Vortheil zum Hizen von Baͤdern, die
man bei Hause zubereiten will, so wie auch zum Heizen von Farbbaͤdern
bedient; er ist eben so einfach, als sinnreich, und scheint der allgemeinen
Beruͤksichtigung in hohem Grade wuͤrdig.
Fig. 2, 3 und 4 zeigen den
neuen Apparat, so wie ihn Hr. Sorel zum Heizen von
Baͤdern anfertigt.
Fig. 2 ist ein
senkrechter Durchschnitt dieses Heizsystemes auf eine Badwanne angewendet.
Fig. 3 ist ein
Grundriß oder eine Ansicht von Oben.
Fig. 4 gibt
einen Aufriß des thermostatischen Hebers fuͤr sich allein.
A, A ist der aus zwei concentrischen, senkrecht
gestellten Cylindern bestehende Kesselofen; der zwischen den beiden Cylindern
befindliche Raum B, B bildet
das Innere des Kessels; waͤhrend der kleinere Cylinder C als Ofen dient. D ist ein beweglicher
Cylinder aus Eisenblech, welcher unten verschlossen ist und beinahe bis auf den
Heerd herabreicht; er ist mit dem Cylinder C
concentrisch, und durch den zwischen ihm und lezterem befindlichen Raum
stroͤmen die durch die Verbrennung erzeugten Gase, um von hier aus durch die
Roͤhre E zu entweichen. Das aus Eisenblech
verfertigte Gefaͤß F dient zum Erwaͤrmen
der Waͤsche, und ist durch eine Schichte Sand G
von dem Heerde geschieden. H ist der Rost, auf den das
Brennmaterial gebracht wird. N stellt die Badwanne vor,
die man hier nur zum Theil abgebildet sieht, und hinter der der Ofen angebracht
wird. Das in dieser Badwanne befindliche Wasser wird mittelst des Hebers durch
fortwaͤhrende Circulation erhizt. Die Circulation hoͤrt nur dann auf,
wenn das in der Badwanne befindliche Wasser in Hinsicht auf Temperatur dem Wasser im
Kessel das Gleichgewicht haͤlt; ist dieß der Fall, so verstopft man das
gebogene Ende b des Hebers I
mit einem Pfropfe; will man die Circulation hingegen wieder herstellen, so braucht
man diesen Pfropf nur herauszunehmen.
Der thermostatische Heber selbst ist mit I, J bezeichnet, und besteht aus zwei Hebern, von denen der
eine die warme Fluͤssigkeit in die kalte, und der andere umgekehrt die kalte
in die warme leitet. Der Heber I,I leitet die warme, der Heber J, J hingegen die kalte Fluͤssigkeit; die
Richtung der Stroͤmungen ist durch Pfeile angedeutet. Der Arm J, K des kalten Hebers ist
in die Roͤhre L, L
eingeschlossen und dadurch gegen die Beruͤhrung mit der heißen
Fluͤssigkeit verwahrt. M, M ist der Wasserbehaͤlter, der zum Ansaugen des Hebers dient.
Man bedient sich dieses Apparates folgender Maßen. Wenn man den Heber in die aus Fig. 2
ersichtliche Stellung gebracht hat, so fuͤllt man das Gefaͤß M mit Fluͤssigkeit, und sezt es wieder auf den
Heber. Das Wasser stroͤmt dann in die Arme und geht in den Behaͤlter
uͤber. In diesem Zustande ist der Heber in Vereitschaft in Thaͤtigkeit
zu gelangen, und die Circulation beginnt also gleich, so wie in der Temperatur der
Fluͤssigkeiten der beiden Gefaͤße ein Unterschied eingetreten ist. Das
Gefaͤß oder der Behaͤlter M wird mittelst
einer gut eingeriebenen Tubulirung auf den Heber aufgesezt, und enthaͤlt eine
Klappe, welche das Austreten des Wassers waͤhrend des Aufsezens des
Behaͤlters hindert, waͤhrend sie sich alsogleich oͤffnet, so
wie sie auf den Heber gebracht worden ist. Der Behaͤlter M communicirt durch eine kleine Roͤhre a mit dem Heber J; direct
dagegen mit dem Heber I.
Tafeln