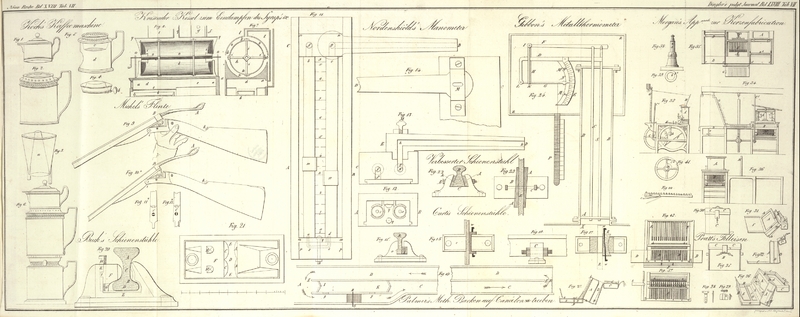| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zur Fabrication gegossener Kerzen, worauf sich Joseph Morgan, Zinngießer von Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 22. Mai 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. XCIX., S. 456 |
| Download: | XML |
XCIX.
Verbesserungen an den Apparaten zur Fabrication gegossener Kerzen, worauf sich Joseph Morgan, Zinngießer von Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 22. Mai 1834 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. April 1838, S. 6.
Mit Abbildungen auf Tab. VII.
Morgan's Apparate zum Kerzengießen.
Der Zwek gegenwaͤrtiger Erfindung ist Erleichterung der Fabrication gegossener Kerzen und Abkuͤrzung der damit verbundenen
Hand-
arbeit. Die hiezu
bestimmten Apparate erhellen aus den beigegebenen Abbildungen, zu deren Beschreibung
ich nunmehr sogleich uͤbergehen will.
Fig. 33 zeigt
meinen Apparat in einem Endaufrisse; Fig. 34 gibt eine
Frontansicht; Fig.
35 ist ein Grundriß; Fig. 36 ein vom
Ruͤken her genommener Aufriß. An allen diesen Figuren ist A der Behaͤlter, worin sich der geschmolzene Talg
oder der sonstige, zur Kerzenfabrication bestimmte Stoff befindet. B hingegen ist eine zum Gießen der Kerzen dienende
Modelreihe. Man sieht diesen Model, der sich von dem gewoͤhnlichen Gießmodel
in mehreren Dingen unterscheidet, in Fig. 37 in
vergroͤßertem Maaßstabe, waͤhrend in Fig. 33 und 39 einige
seiner Theile noch groͤßer dargestellt sind. In Fig. 37 ist b, b ein hohler Cylinder aus Weißblech, der sich der
Laͤnge nach oͤffnet, und der mit so vielen Knaͤueln oder Spulen
baumwollener oder anderer Dochte versehen ist, als Model vorhanden sind. Diese
Spulen drehen sich frei um eine Welle, die der ganzen Laͤnge nach durch den
Cylinder b, b laͤuft; und geben hiebei die
fuͤr die Bildung der Kerzen noͤthige Dochtmenge ab.
Fig. 38 ist
ein Aufriß des oberen Endes von einem der cylindrischen Model, die in den
uͤbrigen Figuren mit B bezeichnet sind. Fig. 39 ist
ein Grundriß hievon, woraus das Innere erhellt. Man ersieht aus diesen beiden
Figuren, daß der obere Theil nicht wie an den gewoͤhnlichen Modeln aus einem
einzigen Stuͤke, sondern aus dem Stuͤke b¹, welches einen Theil der cylindrischen Seite des Models bildet, und
aus dem Stuͤke b², welches verschiebbar
ist, besteht. Lezterer Theil, der zum Behufe des Durchganges des Dochtes hohl ist,
paßt genau an den Theil b¹, so lange der Talg in
den Model gegossen wird. So wie aber die Kerze erkaltet ist und aus dem Model
entfernt werden kann, treibe ich sie, anstatt sie nach der gewoͤhnlichen
Methode auszustoßen, durch einen Druk auf das Ende des Theiles b², durch den der Docht von dem Cylinder b, b her laͤuft, aus. Da der Docht, welcher bei
einem an der Seite des Theiles b befindlichen Loche
austritt, hiebei der Kerze folgt, so wird zugleich mit dem Austreiben der
vollendeten Kerze auch der Docht fuͤr die demnaͤchst zu gießende
eingezogen.
In Fig. 40
sieht man eine Reihe von Zangen, welche sich gleichzeitig mittelst des Hebels C oͤffnen und schließen lassen. Mit diesen Zangen
wird der Docht an dem der Eintrittsstelle entgegengesezten Ende des Models
waͤhrend des Eingießens des Talges in senkrechter centraler Stellung
erhalten.
Man arbeitet nun mit diesem Apparate folgender Maßen. Gesezt ein Modelrahmen B sey gehoͤrig mit Dochten versehen, und diese
Dochte
wuͤrden mittelst der erwaͤhnten Zangen in der Mitte der einzelnen
Mode! erhalten; so bringt man ihn zuerst in jene Stellung, in der man ihn in Fig. 34, 35 und 36 bei B' sieht, und in der er, wie Fig. 35 zeigt, auf den
schmalen geraden Leisten oder Bahnen d, d ruht. In
dieser schiebt man ihn vorwaͤrts, bis er senkrecht unter den mit dem
geschmolzenen Talge oder sonstigen Materiale gefuͤllten Behaͤlter A gelangt. Wenn die Model eingegossen sind, so bewegt
man sie laͤngs der Bahn d, d in irgend eine
bequeme Stellung, in der man sie bis zum Erhaͤrten laͤßt, und in der
man die Zangen, Fig. 40, abnimmt. Haben die Kerzen die gehoͤrige Haͤrte
erlangt, so schafft man die Model B in die aus Fig. 35 zu
ersehende Stellung, in der sie sich auf einer Bahn befinden, welche der auf der
anderen Seite der Maschine mit d, b bezeichneten
vollkommen aͤhnlich ist. Auf dieser schiebt man sie vorwaͤrts, bis sie
an der herabhaͤngenden, um das Gefuͤge e,
e beweglichen Tafel D anlangen. Leztere wird
dann herabgelassen, von dem Arbeiter aber sogleich wieder in die
Laͤngenstellung gebracht, wobei sie den Modelrahmen B mit sich fuͤhrt, und in der sie mittelst des in Fig. 34 bei e' bemerklichen Faͤngers erhalten wird. Aus der
horizontalen Stellung bei D
Fig. 35,
bringt man die Model in die durch den punktirten Pfeil angedeutete Richtung, bis sie
der Stoͤßerreihe E, welche man in Fig. 42 fuͤr sich
allein abgebildet sieht, unmittelbar gegenuͤber kommen. Der Cylinder b, b wird hiebei aus dem Wege geschafft, indem man
dessen gegliederten Rahmen umbiegt, wie in Fig. 43Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. angedeutet ist.
Die Stoͤßerreihe E, welche sich in horizontaler
Richtung frei bewegt, ruht an beiden Enden auf geraden Leisten, und wird durch die
theilweise Umdrehung des Rades C, welches man in Fig. 33 sieht,
in Bewegung gesezt. Ueber den Umfang dieses Rades und uͤber eine
Leitungsrolle f ist eine Kette oder ein Band
geschlungen, welches an der Stoͤßerreihe E
festgemacht ist, so daß jede Schwingung des Hebels c',
der an der Welle des Rades C befestigt ist, in
horizontaler Richtung den Stoͤßern E mitgetheilt
wird. Wenn sich die Model in der aus Fig. 42 ersichtlichen
Stellung befinden, so hat der Arbeiter zunaͤchst den Hebel c¹ in der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung
zu bewegen, und dadurch die Stoͤßer E mit dem
verschiebbaren Theile b' der einzelnen Model in
Beruͤhrung zu bringen, damit hiedurch die Kerzen aus den Modeln ausgetrieben
werden. Leztere werden hiebei von der ausgesalzten Tafel F aufgenommen, die zu diesem Zweke mittelst der auf dem Rade C befestigten Schneke c², auf der die Tafel F ruht, genau in die
erforderliche Stellung gebracht wird. Die aus dem Model getriebenen Kerzen werden
sogleich fest gehalten, indem man den Hebel G, an dem
sich eine ihnen
entsprechende Anzahl kleiner, convexer, blechener Stuͤke von der Form eines
Modeldurchschnittes befindet, herabsenkt. Jedes dieser Blechstuͤke ist an
einer schwachen Feder befestigt; und der Hebel G selbst
wird von einem kleinen Faͤnger niedergehalten. Aus dem, was oben von dem
Modelrahmen B gesagt worden ist, ergibt sich, daß durch
dieselbe Bewegung der Stoͤßer, durch welche die Kerzen aus dem Model
getrieben werden, fuͤr die das naͤchste Mal zu gießenden Kerzen eine
neue Dochtlaͤnge in die Model eingezogen wird; wo dann, waͤhrend die
fertigen Kerzen auf der Tafel F festgemacht sind, die
Zangen wieder angelegt werden, bevor man die fertigen Kerzen abschneidet.
Zunaͤchst hierauf hat der Arbeiter den Hebel c'
in die in Fig.
33 angegebene Stellung zuruͤkzubringen, wodurch die Stoͤßer
E zugleich mit dem verschiebbaren Theile der Model
b² wieder in ihre fruͤhere Stellung kommen und die Dochte so in die
Model eingezogen werden, daß man abermals in sie gießen kann.
Die Stoͤßerreihe E besteht aus einzelnen hohlen
Roͤhren, welche in dem Querstuͤke g, g
ruhen, und von denen jede mit einer kleinen Feder, an deren inneren Seite sich ein
kleiner Vorsprung befindet, versehen ist. Wenn die Stoͤßer gegen den
verschiebbaren Theil b² der Model
angedruͤkt werden, so gibt die Feder nach, und faͤllt, wie Fig. 38 zeigt,
in den ausgekerbten Theil ein, so daß jener in seine fruͤhere Stellung
zuruͤk gelangt, und die Kerzen aus den Modeln ausgetrieben werden. Sobald die
Stoͤßer zuruͤkgezogen werden, und die verschiebbaren Theile b² der entsprechenden Model wieder zuruͤk
gebracht haben, werden die an deren Ende befindlichen Federn, die den Theil b² auf die angegebene Weise festhielten, von
einer zweiten Stoͤßerreihe, die sich inneren der hohlen Stoͤßer empor
bewegt, emporgehoben. Die zweite Stoͤßerreihe ist an einem aͤhnlichen
Querbalken, den man in Fig. 35 bei h, h sieht, befestigt, und dieser wird, sobald als die
Stoͤßer aus den Modeln ausgezogen worden sind, mittelst des Hebels H vorwaͤrts getrieben, wodurch die
Huͤtchen b²,
und die ganzen Model B außer alle Verbindung mit den
Stoͤßern E, E gebracht sind. Um diese Zeit treibt
man hierauf die Model auf der Bahn d, d
vorwaͤrts, bis sie wieder in die Stellung bei B'
gelangen, womit die Arbeit von Neuem beginnt.
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß, wenn man so viele Model hat, daß dieselben
gehoͤrig abkuͤhlen koͤnnen, man mit diesem Apparate eine
beliebige Zeit fortzuarbeiten im Stande ist, und daß hiebei viel Arbeit, Zeit und
Verlust an Docht erspart wird.
Tafeln