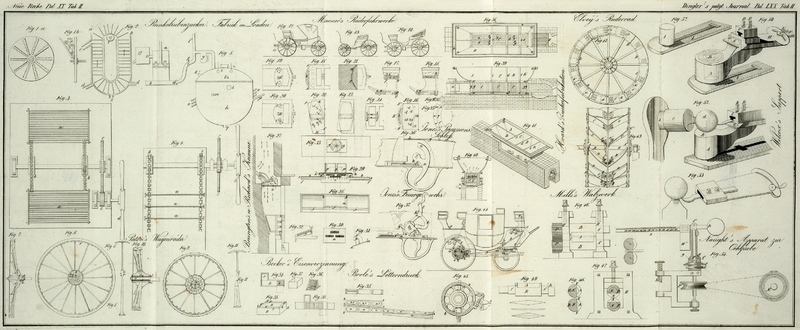| Titel: | Verbesserungen an den Kutschen und Räderfuhrwerken, worauf sich James Macnee, Wagenfabrikant in George Street in Edinburgh, am 21. April 1838 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XVIII., S. 93 |
| Download: | XML |
XVIII.
Verbesserungen an den Kutschen und
Raͤderfuhrwerken, worauf sich James Macnee, Wagenfabrikant in George Street
in Edinburgh, am 21. April 1838 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. August
1838, S. 71.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Macnee's Verbesserungen an Kutschen und
Raͤderfuhrwerken.
Meine Erfindung besteht in einer verbesserten Methode das Vorder- und
Hintergestell eines vierraͤderigen Fuhrwerkes miteinander zu verbinden. Ich
bewerkstellige dieß mittelst eines sogenannten Baumbogens oder Zapfens, den ich in
groͤßerer Entfernung hinter der vorderen Raͤderachse anbringe, als
dieß bisher mit vollkommen durchlaufenden Raͤdern moͤglich war; und
ferner mit einer ein Kreissegment bildenden Platte, die ich eine bedeutende Streke
vor dem Baumzapfen anbringe, und welche mit beiden Wagengestellen verbunden ist;
selbst in solchen Faͤllen, in denen das Fußbrett auf dem einen und der
Kutschersiz auf dem anderen Gestelle ruht. Die Erfindung besteht endlich auch darin,
daß ich dem Size eine Bewegung gebe, gemaͤß der er in Bezug auf das Fußbrett
stets in gehoͤriger Stellung erhalten wird.
In Fig. 12,
13, 14 sieht man
dreierlei verschiedene Fuhrwerke, an denen meine Erfindung angebracht ist, wobei ich
nur noch zu bemerken habe, daß sie sich auch auf jedes andere Fuhrwerk mit einer
Vorder- und einer Hinterachse anwenden laͤßt. In Fig. 12 ist A, B die Linie, in der das Vorder- mit dem
Hintergestelle verbunden ist; in diesem Falle steht demnach nothwendig das Fußbrett
in so inniger Verbindung mit dem Vordergestelle, daß es einen Theil desselben
ausmacht, waͤhrend der Kutschersiz und der Kasten, zu dem das Fußbrett
gehoͤrt, einen Theil des Hintergestelles bildet. Dieselbe Einrichtung findet
auch an den Wagen Fig. 13 und 14 Statt. Die punktirte
Linie C stellt den Baumzapfen vor, der die beiden
Gestelle verbindet, und um den sich der Wagen wie um einen Drehpunkt dreht. Dieser
Drehzapfen befindet sich, wie man sieht, weiter hinter der vorderen Radachse, als
dieß bisher der Fall war. Vor ihm ist zu weiterer vollkommnerer Verbindung der
beiden Gestelle in einer horizontalen Flaͤche ein aus Eisen oder einem
anderen Materiale bestehendes Kreissegment so angebracht, daß der Baumzapfen C sich in dessen Mittelpunkt befindet.
In Fig. 15 und
16 sieht
man diese Segmentplatte im Grundrisse und mit D, E, F
bezeichnet; in Fig.
17 und 18 sieht man sie in einem Querdurchschnitte bei G,
H. Sie wird entweder an der oberen Flaͤche des Vorder- oder
an der unteren Flaͤche des Hintergestelles befestigt. Lezterer Methode,
welche man in den oben erwaͤhnten Querdurchschnitten, Fig. 17 und 18 in
Ausfuͤhrung gebracht sieht, gebe ich den Vorzug. Diese Platte ist mit dem
Baumzapfen concentrisch, d.h. sie bildet ein Kreissegment, in dessen Mittelpunkt
sich der Zapfen befindet. Sie bewegt sich frei auf dem anderen Wagengestelle, auf
dem hiezu ein gehoͤriges mit Reibungsrollen ausgestattetes Lager angebracht
ist, wie man in Fig. 19 und 20 bei I, I sieht. Zu noch weiterer und sichererer Verbindung
der beiden Gestelle dient ein Zapfen K, den man in Fig. 15, 16, 19 und 20 sieht, und
der an jenem Theile des Wagengestelles, auf dem die Segmentplatte ruht, spielt. Der
Hals dieses Zapfens bewegt sich in einer in die Platte geschnittenen Spalte, welche
mit der Platte selbst gleichfalls wieder concentrisch gebildet ist, damit sich der
Zapfenhals bei der Durchlaufsbewegung frei in der Spalte schieben kann. Der Kopf des
Zapfens ist breit und flach, damit er die Segmentplatte in groͤßerer
Ausdehnung bedekt, und damit diese mit der Tragoberflaͤche der Reibungsrollen
in Beruͤhrung erhalten wird. Noch deutlicher sieht man diesen
Verbindungszapfen in Fig. 17 und 18 bei L.
Fig. 21 zeigt
das Fußbrett im Grundrisse, woraus die Verbindung desselben mit dem hinteren
Wagengestelle erhellt. M, N ist die Verbindungslinie,
welche mit der Segmentplatte und dem Baumbolzen O
concentrisch ist. Ich finde es geeignet, diese Verbindungslinie mit einem
Messing- oder Eisenstreifen zu bedeken.
Fig. 22 ist
ein Grundriß eines beweglichen Sizbrettes P, Q, R, S,
welches zwar als zum Theile weggebrochen dargestellt ist, dessen Stellung jedoch
durch punktirte Linien angedeutet ist. Dieses Sizbrett erhaͤlt eine solche
Bewegung mitgetheilt, daß der Siz nicht viel von der Stellung, die er in Bezug auf
das Fußbrett haben soll, abweicht; d.h. mit anderen Worten, der Siz kann aus der
hier angedeuteten Stellung in die aus Fig. 23 ersichtliche und
in jede andere Stellung kommen, welche in dieser Figur durch punktirte Linien
angedeutet ist.
Fig. 17 und
24 zeigen
wie die verschiedenen, mit dem Size in Verbindung stehenden Theile angeordnet und
gebaut sind. T, U, in Fig. 17, ist der
Baumzapfen, dessen Kopf man bei U sieht, waͤhrend
sich sein Scheitel bei T und der Hals bei V befindet. Der Hals ist vierkantig gebildet, damit er
sich mit dem Vordergestelle umdrehen muß. Von diesem Halse an laͤuft der
Zapfen jedoch wieder frei durch das Hintergestell, bis er bei W wieder eine vierkantige Form annimmt, und dann mit dem aus Fig. 24
ersichtlichen Hebel X, Y
in Verbindung tritt.
Dieser Hebel hat gleiche Arme und ist an seinen Enden durch Bolzen und Scheiden mit
den Staͤben a, b verbunden, die ihrer Seits mit
den Armen des Hebels c, d in Verbindung stehen. Lezterer
Hebel ist in jeder Hinsicht dem Hebel X, Y
aͤhnlich, so daß auf diese Weise ein beweglicher Rahmen gebildet wird, der
sich in seiner Mitte um einen Zapfen e, f, Fig. 17,
welcher in paralleler Richtung mit dem Baumzapfen T, U
angebracht ist, bewegt. Dieser Zapfen ist da, wo er durch den Scheitel des
Sizbrettes g geht, abgerundet, da hingegen, wo er durch
den Hebel c, d geht, ist er wieder vierkantig, damit das
Sizbrett h hiedurch in Bewegung gebracht werden kann.
Das Sizbrett bewegt sich auf fixirten Platten, Zapfen oder Reibungsrollen, die in
Fig. 17
und 22 mit
i, i bezeichnet sind. Die Bewegung findet in einer
horizontalen Flaͤche um den Zapfen e, f Statt,
damit es waͤhrend des Durchlaufens des Wagens fortwaͤhrend in einer
mit dem Fußbrette harmonirenden Stellung erhalten wird. In den bereits
erwaͤhnten Fig. 16 und 18 sieht man eine
Modification der Methode, nach welcher der Siz in einer dem Fußbrette entsprechenden
Stellung erhalten werden soll. Das, wodurch sich diese Modification von der bei Fig. 17 und
24
beschriebenen Methode unterscheidet, beruht darauf, daß der Zapfen e, f und die Parallelbewegung X,
Y beseitigt ist; und daß das bewegliche Sizbrett direct bei k auf dem oberen, vierekig geformten Theile des
Baumzapfens fixirt ist, so daß, wenn der Baumzapfen umgedreht wird, der Siz sich mit
herum bewegen und die Achse des Baumzapfens als Drehpunkt nehmen muß. In diesem
Falle muͤssen die Achsen der Reibungsrollen gegen den Baumzapfen gerichtet
seyn, wie man dieß bei l sieht, damit sie den Siz tragen
und ihm eine freie Bewegung gestatten.
In Fig. 25
ersieht man eine Methode, nach der das an dem einen Wagengestelle angebrachte
Durchlaufsegment mit dem an dem anderen Wagengestelle befindlichen, mittelst einer
im Kreise laufenden Fuge oder eines genau einpassenden Segmentes verbunden ist. Der
Theil m, n, o ist an dem einen, der Theil p, q, r dagegen an dem anderen Wagengestelle befestigt.
Eine an dem einen befindliche Leiste und ein dieser entsprechender Falz an dem
anderen laͤßt eine freie, horizontale Bewegung um den Baumzapfen S herum zu. Aus dem Querdurchschnitte Fig. 26 erhellt die eben
erwaͤhnte Leiste und auch der Falz.
Ich habe nun nur noch zu bemerken, daß ich in Fig. 13 die Form und
Stellung des Baumzapfens in Bezug auf die hier dargestellte Art von Fuhrwerk
angedeutet habe. Da uͤbrigens die Segmentplatte hier auf dieselbe Weise
angewendet ist, wie an den anderen Fuhrwerken, so bedarf es keiner weiteren Beschreibung. Der
Baumzapfen, die Segmentplatte, die Vereinigungsbolzen und Muttern, die Hebel, die
Arme, die Scheiden, die Lager, die Walzen und alle uͤbrigen einem Druke,
einer Bewegung und Reibung ausgesezten Theile sollen aus Eisen oder einem anderen
tauglichen Metalle oder auch aus einem sonstigen Materiale von hinreichender
Staͤrke und Dauer verfertigt werden.
Ich will, nachdem ich somit die von mir erfundenen Anordnungen beschrieben, auch
angeben, wie das Spiel derselben von Statten geht. Wenn naͤmlich das
Vordergestell beim Wenden des Wagens um seinen Mittelpunkt gedreht wird, so drehen
sich die Raͤder und ihre Achse so herum, daß das innere Rad nicht mit dem
Wagen in Conflict kommt. Es ist mithin mit einem Rade von einer gegebenen
Groͤße ein weiterer Durchlauf oder mit einem gegebenen Grade von Durchlauf
ein groͤßeres Rad moͤglich, als dieß bei der aͤlteren Methode,
bei welcher der Baumzapfen weiter vorne angebracht wurde, thunlich war. Zugleich ist
dem Vordergestelle durch die Verbindung der Segmentplatte mit seinem Bolzen
groͤßere Staͤrke und Staͤtigkeit gegeben. Wenn ferner das
Vordergestell umgedreht wird, so zwingt die vierseitige Scheide den Baumzapfen, sich
gleichfalls mit herum zu drehen. Dieser wirkt daher auf die aus den beiden Hebeln
und den ihnen entsprechenden Stangen bestehende Parallelbewegung, woraus dann folgt,
daß gleichzeitig auch der Siz oder Bok in einer dem Fußbrette entsprechenden
Stellung bewegt wird. Dieselbe Wirkung, wie sie durch die eben erwaͤhnte
Parallelbewegung hervorgebracht wird, tritt auch dann ein, wenn der bewegliche Siz
direct auf dem oberen vierekigen Theile des Baumzapfens angebracht ist; denn dann
muß sich der Siz um diesen Zapfen als um seinen Mittelpunkt drehen.
Meine Methode gewaͤhrt folgende Vortheile: 1) sind die zu ihr erforderlichen
Theile leichter und einfacher als jene, deren man sich bisher bediente; 2)
laͤßt sie groͤßere Vorderraͤder zu, als sie bisher
moͤglich waren, wodurch den Pferden das Ziehen erleichtert wird; 3) sehen die
meiner Methode gemaͤß gebauten Fuhrwerke leichter und eleganter aus; 4) ist
die Bewegung meiner Wagen wegen der Festigkeit und wegen der guͤnstigen
Stellung der tragenden Theile weit ruhiger und staͤtiger.
Da ich sehr wohl weiß, daß meine Vorrichtungen sehr mannigfache Modificationen
zulassen, so binde ich mich an kein bestimmtes Kreissegment, noch auch an irgend
eine bestimmte Form oder Dimension der Zapfen.
Tafeln