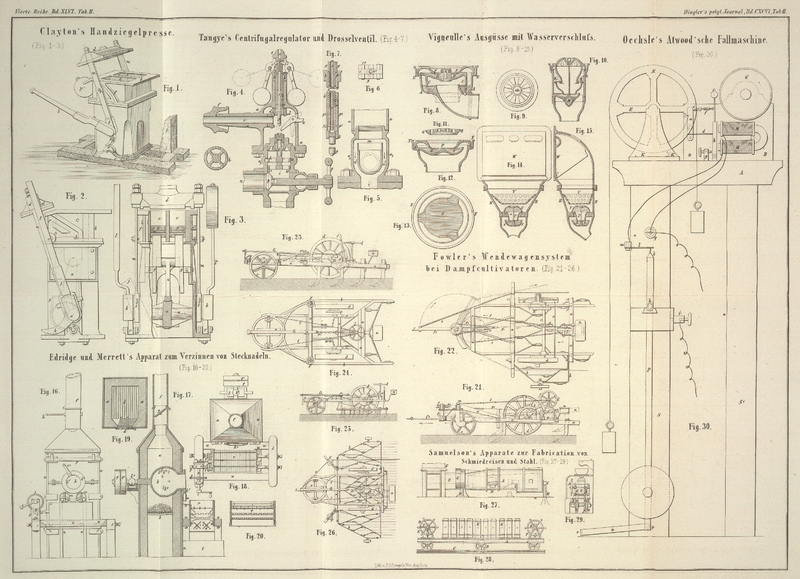| Titel: | Apparat zum Verzinnen von Nägeln, von Haken und Oesen für Kleidungsstücke, und anderen kleinen Artikeln; von J. Edridge und J. Merrett in Birmingham. |
| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. XXXVII., S. 122 |
| Download: | XML |
XXXVII.
Apparat zum Verzinnen von Nägeln, von Haken und
Oesen für Kleidungsstücke, und anderen kleinen Artikeln; von J. Edridge und J. Merrett in Birmingham.
Aus dem Mechanics' Magazine, Januar 1870, S.
26.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Edridge und Merrett's Apparat zum Verzinnen von Nägeln
etc.
Dieser Apparat, welchen sich die Erfinder patentiren ließen, ist zunächst zum
Verzinnen von Nägeln bestimmt, kann aber ebenso gut auch
zum Verzinnen von Haken und Oesen für Kleidungsstücke, und von anderen kleinen
Artikeln verwendet werden. Fig. 16 stellt denselben
in der Vorderansicht, Fig. 17 im
Verticaldurchschnitt und Fig. 18 im Grundriß dar;
Fig. 19
ist ein Querschnitt durch den Feuerraum und Fig. 30 ein verticaler
Längenschnitt durch den Siebapparat.
a ist der Ofen, welcher entweder aus einer Metallhülle
mit einem Futter von feuerfesten Ziegeln besteht, oder nur aus Ziegeln aufgeführt
ist; b ist der Rost, c der
Aschenfall, d die Feuerthür, e die Thür des Aschenfalles; f ist die Esse.
Zur Regulirung des Zuges dient entweder die Klappe g
oder ein gleitender Schieber. In dem Ofen können sowohl Kohks als Kohlen auf dem Roste
b verbrannt werden, oder es kann Gasfeuerung
entweder für sich allein oder in Verbindung mit festem Brennmaterial in Anwendung
kommen. Zu letzterem Zwecke wird der Ofen mit den nothwendigen Brennern versehen.
k ist das kugelförmige Verzinnungsgefäß, welches
über der Feuerstelle liegt. Dasselbe liegt in nahezu horizontaler Stellung, und kann
umgedreht werden. Zu diesem Zwecke ruht es einerseits mit der Kugel k² auf dem Lager l,
welches hohl gegossen ist, und durch darin circulirendes Wasser kühl erhalten wird.
i, i sind die Röhren für den Zu- und Abfluß
des Wassers. Das Vorderende des Gefäßes k liegt mit der
Flantsche k³ auf zwei Frictionsrollen m, m, welche an einem Ständer n befestigt sind. Ueber der Mündung des Verzinnungsgefäßes k ist ein (in der Figur weggelassener) Hut angebracht,
um die beim Verzinnen sich entwickelnden Dämpfe in die Esse f abzuführen. Mittelst der Fest- und Losscheibe q, q' kann das Verzinnungsgefäß durch einen Riemen in
Rotation gesetzt werden. Wird dasselbe durch Elementarkraft getrieben, so versieht
man es noch mit einer Kurbel s² am Stirnende, um
es in die passende Stellung zum Entleeren zu bringen. k⁴, k⁴ sind kleine Vorsprünge an der
Innenfläche des Verzinnungsgefäßes k. Nur ungefähr drei
Viertel des Umfanges sind mit solchen Vorsprüngen besetzt, während der übrige Theil
glatt ist. Unterhalb der Mündung des Verzinnungsgefäßes befindet sich ein
horizontales Sieb oder ein Rost r, r, welchem eine
hin- und hergehende Bewegung ertheilt werden kann, und unterhalb dieses
Siebes befinden sich zwei Flügelräder zur Beschleunigung des Herabfallens der
verzinnten Nägel, nachdem sie das Sieb verlassen haben. t ist ein Wassergefäß, in welches die verzinnten Artikel aus dem Siebe zum
Abkühlen fallen.
Das Sieb r, r ist folgendermaßen eingerichtet: Es besteht
aus einem Rahmen oder Kasten, in welchem eine Reihe longitudinaler Drähte und
Drahtgeflechte ausgespannt sind. Oben auf dem Kasten liegen die Längendrähte, welche
in kurzen Zwischenräumen mit verticalen und horizontalen Stäbchen versehen sind.
Unter diesen Drähten sind zwei Siebe aus verschlungenem Drahte. Geneigte
Seitenplatten in dem Siebe dienen dazu, die fallenden Nägel in die Mitte der Siebe
und zwischen die Flügel s, s zu leiten. Durch diese
Einrichtung der Siebe werden die verzinnten Artikel in sehr wirksamer Weise von
einander getrennt, ehe sie in das Wassergefäß t fallen.
Unten an jeder Seite des Siebes befindet sich eine Schiene v mit Vorsprüngen, welche sich gegen den Rand w der Stangen u, u legen, um die Reibung des
Siebes zu vermeiden. Die hin- und hergehende Bewegung des Siebes erfolgt
durch eine Bleuelstange x, welche an einem Ende mit dem
Siebe und am anderen mit dem Zapfen der Kurbelscheibe y in Verbindung steht.
Diese letztere steckt auf dem Ende der Welle z, und wird
von Hand mittelst der Kurbel l, des Rades 2 und eines
auf der Welle z der Kurbelscheibe sitzenden Getriebes in
Umdrehung gesetzt. Die Flügel s, s sind etwas länger als
das Sieb, und werden mittelst einer über die Rollen 4 an ihren Achsen gehenden
Schnur getrieben. Die Lager der Flügel ruhen auf den Ständern 5, 5. Diese Ständer
tragen auch die Stangen u, u, zwischen welchen sich das
Sieb bewegt.
Bei Benutzung dieses Apparates werden die Nägel oder sonstige Artikel zum Verzinnen
in das kugelförmige Verzinnungsgefäß k eingebracht, und
darin erhitzt. Hierauf bringt man das nöthige Zinn ein, und streut gepulverten
Salmiak mittelst eines Löcherlöffels darüber. Sodann rückt man den Riemen von der
Los- auf die Festscheibe q'; das Verzinnungsgefäß
und sein Inhalt gerathen in Drehung, wobei die Nägel etc. durch die Vorsprünge k⁴ an der Innenseite des Gefäßes in sehr
wirksamer Weise umgekehrt werden. Auf diese Weise werden die zu verzinnenden
Gegenstände gleichmäßig erwärmt, und Zinn und Salmiak gleichförmig über sie
ausgebreitet; ist dieß gehörig geschehen, so hält man die Drehung des
Verzinnungsgefäßes an, indem man den Riemen auf die Losscheibe legt, und dreht nun
die Kurbel s² so daß die glatte Seite oder der
nicht mit Vorsprüngen besetzte Theil des Gefäßes k zu
unterst zu stehen kommt. Sodann zieht man die verzinnten Gegenstände mittelst einer
Krücke von passender Form heraus, wobei sie auf das horizontale hin- und
hergehende Sieb r, r fallen. Durch die Wirkungen des
Siebes werden die verzinnten Nägel etc. von einander getrennt, und von den Flügeln
s, s rasch in das Wassergefäß t geschleudert, um abzukühlen. Hier kommen sie in einen Trog auf dem Boden
des Gefäßes zu liegen, durch dessen Herausnahme sie entfernt werden können.
Beim Verzinnen hakenförmiger Gegenstände, als Fischangeln und Haken und Oesen für
Kleidungsstücke, wird ein hin- und hergehender Schüttelkasten anstatt des
vorbeschriebenen Siebes angewendet, da die genannten hakenförmigen Gegenstände in
den Drähten oder Maschen des Siebes hängen bleiben würden. Die Seiten dieses
Schüttelkastens sind mit geneigten Platten oder Gesimsen versehen, eine über der
anderen, oder mit einer Reihe von geneigten Drähten. Durch die Bewegung des
Schüttelkastens fallen die auf dem obersten Gesimse der einen Seite abgelagerten
Häkchen etc. auf das nächst untere der entgegengesetzten Seite und so weiter.
Hierdurch werden die verzinnten Gegenstände von einander getrennt, ehe sie den
Kühlbottich erreichen. Obwohl die Erfinder vorziehen, die Siebe r, r oder den vorbeschriebenen Schüttelkasten in
Verbindung mit dem
rotirenden Verzinnungsgefäße k zu verwenden, so kann das
letztere für sich allein ohne Siebe und Flügel benutzt, und die Separation und
Abkühlung der verzinnten Artikel nach der gewöhnlichen Methode vorgenommen
werden.
Tafeln