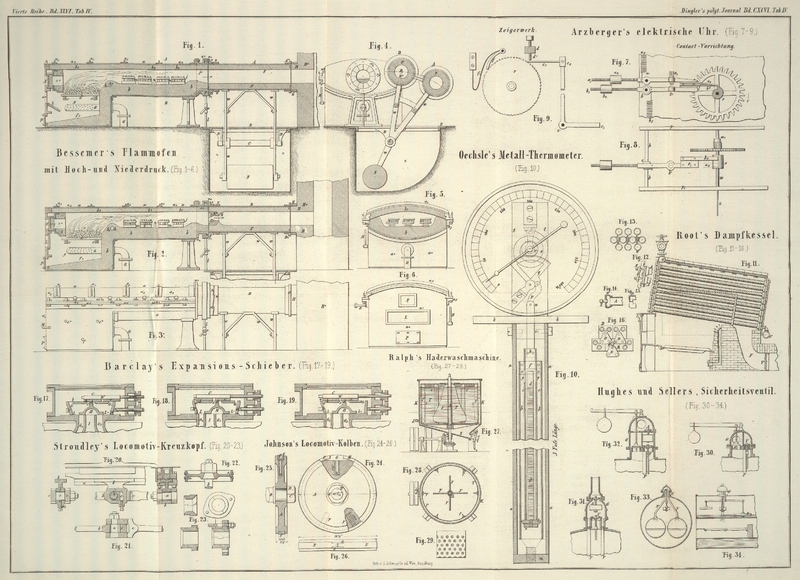| Titel: | HenryBessemer's Flammofen mit Hoch- und Niederdruck. |
| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. LXVIII., S. 220 |
| Download: | XML |
LXVIII.
HenryBessemer's Flammofen mit Hoch- und Niederdruck.
Aus Engineering, Januar 1870, S.
39.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Bessemer's Flammofen mit Hoch- und Niederdruck.
Wir haben vor einiger Zeit bei Mittheilung von Henry Bessemer's System der Hochdrucköfen für die
Stabeisen- und StahlfabricationPolytechn. Journal, 1869, Bd. CXCIII S. 376. einen Hochdruck-Kupolofen nach
beigegebener Abbildung beschrieben und kürzlich Bessemer's Anwendung dieses Constructionsprincips auch auf die Converter
Polytechn. Journal, 1870, Bd. CXCV S. 331. nach seiner Patentbeschreibung nachgetragen.
Durch den hier zu beschreibenden Flammofen zur
Gußstahl-Fabrication bezweckt der Erfinder die bei der beständigen Anwendung
des Hochdrucksystemes unvermeidliche starke Abnutzung des Apparates zu vermindern,
und zwar in der Weise, daß die Einsätze durch Betrieb des Ofens mit dem gewöhnlichen
Essenzuge angewärmt werden, wornach man zur Erzielung der schließlich erforderlichen
höheren Temperatur das Hochdrucksystem anwendet.
Figur 1 stellt
einen Längendurchschnitt durch Ofen und Fuchscanal dar, wie die Anordnung für das
Anwärmen ihn ergibt, während Fig. 2 denselben
Durchschnitt mit den zur Erzeugung hohen inneren Druckes erforderlichen
Veränderungen in den Fuchsdimensionen vorstellt.
Figur 3 gibt
eine Seitenansicht des Ofens, Fig. 4 eine Endansicht mit
hinweggedachter Esse, Fig. 5 einen Querschnitt
durch den Herd und Fig. 6 eine Stirnansicht der Feuerseite.
In den Abbildungen ist a die äußere Armatur des Ofens,
aus zusammengenieteten und verstemmten Eisen- oder Stahlplatten von
bedeutender Festigkeit bestehend, an welche die Stirnplatte a* von Gußeisen mittelst Flanschen und Winkeleisen so fest angeschlossen
ist, daß gasförmige Producte nicht zu entweichen vermögen. Das Futter d des Ofens besteht aus feuerfesten Steinen. Der
Feuerraum c ist rechtwinklich und enthält einen aus
Walzeisenstäben d construirten Rost, der auf ebenfalls
gewalzten Rostbalken e ruht.
Die Enden der Rostbalken ragen aus der Armatur der Seitenwände hervor bei e* und dienen als Ankerstäbe, während ein dritter
wirklicher Ankerstab f durch den Aschenfall gelegt ist. Die Feuerbrücke b* hat ein Wasserkühlungsrohr h, um das Mauerwerk zu schützen.
Der Herd m des Ofens ist fast waagrecht und hat nur an
der Seite, nach dem Abstich n zu, eine geringe
Einsenkung, um den Abfluß der Charge zu erleichtern. Das bewegliche Gewölbe a₂ ist aus starken Stahl- oder
Eisenplatten zusammengesetzt und außerdem noch mit T-Schienen a₃ versteift, während die
starken Längsflanschen a₁ einen festen Rückhalt
für das feuerfeste Futter abgeben und gleichzeitig mittelst der Keilbolzen i, i die Verbindung mit dem unteren Theil des Ofens
herstellen. Diese Bolzen ragen durch den Flansch des Untertheiles a₅ und werden oberhalb des oberen Flansches mit
den Keilsplinten versehen. Entfernt man dieselben und die Bolzen, so läßt sich
jederzeit der Ofen mit Hülfe starker Krahne aufdecken, wozu einige Ringe an den
Seitenflanschen befestigt sind. Die Paßflächenfugen beider Ofenhälften werden durch
Thonbrei gedichtet, wenn der Ofen wieder zusammengesetzt wird.
Bei j zieht sich der Herd der Breite nach zusammen und
endet bei j∗ in
einer kreisrunden Oeffnung, durch welche die Einsätze k
vor Beginn des Betriebes in der durch die Zeichnung veranschaulichten Weise in dem
Ofen angeordnet werden. An dieser Stelle ist die gußeiserne Stirnplatte des Ofens
mit einem dicken Flansch versehen, der hohl ist und einen Canal r enthält. Dieser Canal ist bestimmt, comprimirte Luft
aufzunehmen, welche durch das Rohr l und den Hahn o ihren Zugang findet. Aus dem Ring tritt durch viele
feine Oeffnungen r∗ eine größere Anzahl Luftstrahlen zwischen die Paßflächen des
Ofens und des Ringes s an dem beweglichen Fuchse; sie
verhindern das Ausbrechen von Verbrennungsproducten an dieser mehr oder minder
empfindlichen Stelle.
Um nun nach Belieben mit gewöhnlichem Luftzug oder mit Hochdruck zu arbeiten, wendet
Bessemer die auf einer horizontalen Achse C befestigten doppelten Füchse A und B an. Die Lager D der Achse C sind Hängelager und an der
Unterseite der Bodenplatten E angeschraubt. Die Füchse
A und B haben vernietete
eiserne Armaturen und sind mit segmentförmigen Façonsteinen F gefüttert. An einem Ende des Fuchses A ist ein Flansch A∗ und am Fuchs B
ein eben solcher Flansch B∗ angebracht, dazu bestimmt, sich an einen eisernen Ring G zu fügen, welcher über einem aus der Esse H∗
hervortretenden Canal H sich befindet. Die anderen Enden
der Füchse tragen lose Ringe s, deren eine Seite mit
einer rund umlaufenden halbkreisförmigen Nuth versehen ist, während die andere eine
Reihe von schrägen Segmentflächen, wie eine Walzwerkskuppelung gebildet, zeigt
(siehe s∗ in Figur 3).
Diesem Ring entspricht ein anderer auf den Füchsen festgenieteter u; steckt man nun einen Hebel in die Oeffnung v des Ringes s und dreht
denselben nach einer bestimmten Richtung, so schieben sich die schrägen Flächen auf
einander und der Ring s wird mit seiner dem Ofen
zugekehrten Fläche fest an denselben angedrückt. Die Länge der Füchse A und B, deren
Bewegungsmechanismus aus der Zeichnung deutlich erhellt, ist stets so groß zu
nehmen, daß zwischen Ofen und Esse hinreichend Raum für die Arbeiter bleibt, um den
Ofen bequem zu besetzen.
Sind beide Füchse bei Seite gedreht (Figur 4), so werden die
Materialien in den Ofen gebracht, der Fuchs A
vorgeschoben und durch Andrehen der verzahnten Scheibe s
gegen den Ofentheil j∗ gedrückt. Damit ist eine gewöhnliche Essenfeuerung hergestellt
und es wird bei offener Aschenfallthür L (mit dem
Handgriff M) losgefeuert, indem man die Oeffnung C∗, welche sonst
durch die Thür N dicht verschlossen werden kann,
benutzt. Diese Thür N wird durch den Griff O (Figur 6) waagrecht hin und
her bewegt, indem sie genau an der Armaturplatte a∗ anliegt und nach der Feuerseite durch ein
Futter N∗
geschützt ist.
Die Arbeit verläuft nun folgendermaaßen: Ist der Ofen in der durch Figur 1 veranschaulichten
Weise zusammengesetzt und angeheizt, so feuert man bei gewöhnlichem Luftzug, bis die
Einsätze weißglühend sind und Schweißhitze eintritt. Dann wird der Rost rein gemacht
und reichlich mit Brennmaterial beschüttet, Feuerthür und Aschenfall werden dicht
und sicher verschlossen und der Fuchs A gelöst. Sobald
der Fuchs B mit seiner engen Mündung angeschlossen ist,
wird der Fuchs des Ringes s und des Ofenflansches durch
Oeffnen des Lufthahnes o mit Luft gedichtet und
schließlich Unterwind gegeben.
Der Unterwind gelangt durch das vielfach durchlöcherte Rohr Q in den geschlossenen Aschenfall und verbreitet sich daselbst, um sehr
kräftig auf den Rost zu wirken.
Der Druck, welchen Bessemer anwendet, ist derselbe wie bei
seinen Kupolöfen, nämlich 30–50 Pfd. pro
Quadratzoll und derselbe veranlaßt eine intensive Verbrennung der Brennstoffe; die
Wirkung wird dadurch erhalten, daß der Fuchs B mit einem
feuerfesten Einlaßmund R∗ versehen ist, der viel zu klein angeordnet wird, um eine rasche
Ausgleichung der Temperatur herbeizuführen. Das Querschnittsverhältniß zwischen
dieser Fuchsöffnung und der Rostfläche ist gewöhnlich wie 1 : 12; es hängt jedoch
von der Pressung ab, mit welcher der Ofen betrieben werden soll.
In kürzester Frist wird der Einsatz flüssig und kann abgestochen werden; man mischt
demselben die Zusätze entweder dann erst bei oder setzt sie gleich mit in den Ofen,
wiewohl in letzterem Fall das ungleiche Verhalten derselben und des Schmiedeeisens und Stahles
unzuträglich für die Homogenität und die Güte des Productes wirken dürfte.
Wir hoffen, bald Details über Resultate bei dem Betrieb dieses Ofens mittheilen zu
können.
Tafeln