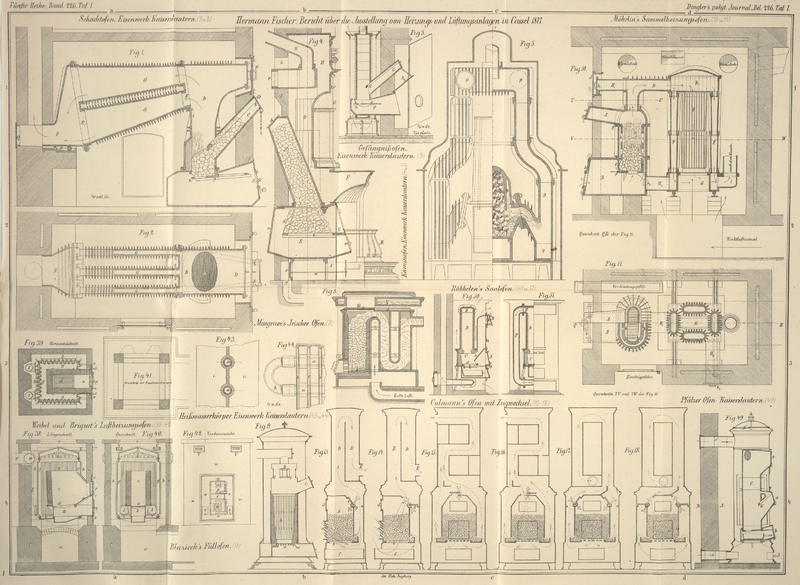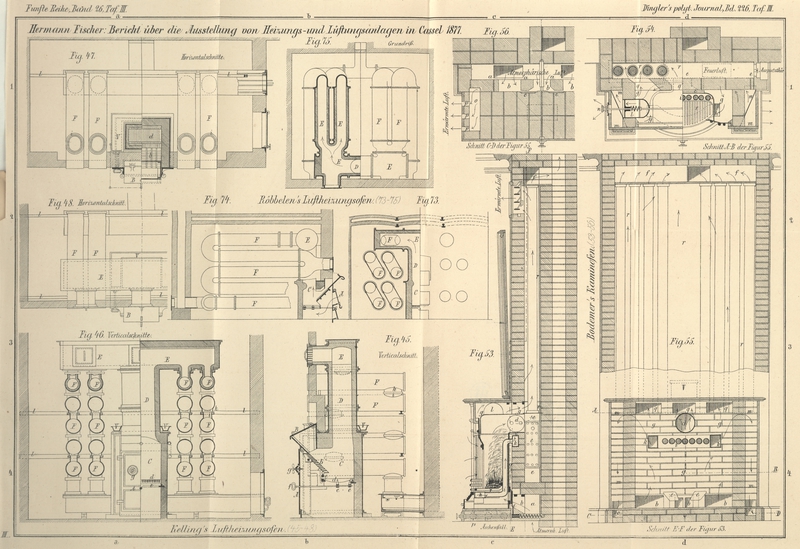| Titel: | Bericht über die Ausstellung von Heizungs- und Lüftungs-Anlagen in Cassel; von Hermann Fischer. |
| Autor: | Hermann Fischer |
| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 113 |
| Download: | XML |
Bericht über die Ausstellung
von Heizungs- und Lüftungs-Anlagen in Cassel; von Hermann
Fischer.
Mit Abbildungen im Text und
auf Tafel I bis III.
(Fortsetzung von S. 15 dieses
Bandes.)
H. Fischer, über Heizungs- und
Lüftungsanlagen.
2) Die Wände und
sonstigen Mittel, welche die erzeugte Wärme
übertragen.
Die Ueberführung der Wärme aus den Verbrennungsgasen in die Luft
oder in Wasser und von Wasser oder Dampf in Luft findet
Widerstand bei dem Uebergang aus den Feuergasen in die sie
einschließende Wandung, bei der Leitung in der Wand und endlich
bei dem Uebergang in das dritte Mittel. Diese drei Theile des
Gesammtwiderstandes müssen für sich betrachtet werden, will man
über den Gesammtvorgang Klarheit sich verschaffen.
Der leitende Wärmeübergang aus dem einen in das andere Mittel
findet selbstverständlich nur in der Berührungsfläche statt.
Würde demnach die Luft oder der Rauch in Ruhe sich befinden, so
würde der Uebergang der Wärme nur in dem Maße stattfinden, wie
die Wärme durch die ruhige Luft geleitet wird. Da diese Leitung
eine sehr geringe ist, so würde zwischen der
Oberflächentemperatur der Wand und der Oberflächentemperatur der
Luft nur ein geringer Unterschied herrschen, dem entsprechend
also der Wärmeübergang ein geringer sein, weil derselbe, wie wir
anzunehmen Grund haben, im Verhältniß des
Temperaturunterschiedes stattfindet, welch letztern wir aber
nicht messen, weil wir unsere Meßinstrumente bis jetzt noch
nicht in die unmittelbare Nähe der Uebergangsfläche zu bringen
vermögen.
Bewegt sich die Luft längs der Fläche, so kommt fortwährend Luft
anderer Temperatur mit der Fläche in Berührung, die
wärmeleitende Eigenschaft der Luft kommt weniger in Frage, es
wird der Temperaturunterschied in der Berührungsfläche ein
größerer, also auch die Wärmeüberführung. Je größer die
Geschwindigkeit des Luftwechsels, um so wehr wird an der die
Wand berührenden Oberfläche der Luft diejenige Temperatur
derselben vorhanden sein, welche unsere Meßapparate uns
anzeigen, so daß bei unendlich großer Geschwindigkeit beide
Temperaturen sich gleich sein müssen, also die Wärmeüberführung
das denkbar Größte erreicht.
Lediglich um die Auffassung des Gesagten zu erleichtern, erinnern
wir an den Gebrauch des Fächers. Im schwülen Raume ist der
Aufenthalt ein unangenehmer. Es wird zum Fächer gegriffen und
durch geschickte Bewegung desselben eine Luftströmung an der
Oberfläche der Haut – des Antlitzes, des Nackens und der
Büste – erzeugt. Wie wohl thut die entstehende Kühlung!
Aber die Lufttemperatur ist dieselbe geblieben, nicht weniger
die Blutwärme; letztere wird sogar erhöht, wenn auch in geringem
Maße, durch die Arbeit des Fächelns; und doch die angenehme
Kühlung. Sie wird allein dadurch hervorgerufen, daß die Wärme
der die Haut berührenden Luftoberfläche sich der allgemeinen
Zimmerwärme nähert, sich also von der Wärme der Hautoberfläche
entfernt.
Die übeln Erkältungsfolgen des „Zuges“ sind
ebenfalls hierdurch erklärt.
Zwischen den beiden Grenzfällen – vollständig ruhender
Luft und unendlich rasch bewegter Luft – welche niemals
in Wirklichkeit erreicht werden können, befindet sich nun eine
unendliche Zahl von Zuständen, die entweder dem einen oder dem
andern Grenzzustande näher liegen. Wir rechnen mit in der Mitte
liegenden Fällen, weil uns noch nicht die genügenden
Versuchsergebnisse vorliegen, um richtig rechnen zu können; wir
nehmen durchschnittliche Werthe, obgleich dieselben
außerordentlich von denjenigen Grenzwerthen abweichen, die in
der Wirklichkeit vorkommen. Dies ist vielfach Ursache gewesen,
daß Praktiker jede Rechnung als unzutreffend und nutzlos
verwarfen, oder sich doch mit wenig entsprechenden
Faustrechnungen begnügten.
Wie erwähnt, kennen wir die einschlagenden Gesetze noch nicht
genügend, um sie unmittelbar den Formeln einzuverleiben, welche
wir zur Berechnung von Beheizungskörpern benutzen. Es ist das
die zweite sehr fühlbare Schwäche der gegenwärtigen
Beheizungstechnik, welche aber eine Berücksichtigung der
betreffenden Vorgänge nicht ausschließt, wenn diese
Inbetrachtnahmen auch nur den Werth von Schätzungen haben.
Die mehrerwähnte Bewegung der Luft kann hervorgehen aus irgend
einer äußern Ursache, oder sie kann entstehen aus dem hier zu
behandelnden Vorgange selbst, nämlich aus der stattfindenden
Wärmeübertragung.
Durch jede Temperaturänderung der Luft oder der Rauchgase wird
deren Gewicht verändert. Dies ist die Quelle der Bewegung,
welche uns durch den letztgenannten Vorgang geboten wird. Jede
Wärmeentziehung veranlaßt das Bestreben des Niedersinkens, jede
Wärmezunahme dasjenige des Steigens. Eine nach unten gerichtete
wagrechte Wandfläche ist daher wenig geeignet, Wärme an die Luft
abzugeben, Wohl aber zur Wärmeaufnahme. Eine derartige nach oben
gerichtete Fläche verhält sich grade umgekehrt. Aufrechte
Flächen sind zu beiden Vorgängen gleich gut tauglich; der
Luftwechsel an denselben ist ein solcher, welcher zwischen den
beiden vorhin genannten, dem günstigen, bezieh. ungünstigen
liegt.
Flächen, welche durch ihre Nachbarschaft gegen wirksame Bespülung
durch Wärme abgebende, oder Wärme aufnehmende Gase geschützt
werden, sind für unsere Zwecke nicht geeignet, soweit es sich um
möglichst rasche Wärmeüberführung handelt; sie sind uns aber
erwünscht, wenn eine rasche Wärme-Abgabe oder Aufnahme
verhindert werden soll.
Bezüglich der aufrechten Wärmeübertragungswände ist noch auf
folgende Verschiedenheiten aufmerksam zu machen. Es ist entweder
möglich, die Wärme abgebenden Gase aufwärts oder abwärts zu
führen. In ersterm Falle werden die abgekühlten Gase, vermöge
ihres Bestrebens nach unten zu sinken, der vorgeschriebenen
Bewegung entgegen wirken; sie werden nur in dem Maße an der nach
oben gerichteten Bewegung theilnehmen, als sie von den noch
nicht abgekühlten Gasen mitgerissen werden. Sie bleiben also so
lange als möglich zurück.
Die heißern Gase suchen natürlich auf dem bequemsten Wege nach
oben zu gelangen; letzterer liegt aber offenbar nicht an der
Wärmeübergangsfläche, weil hier nicht allein die Reibung an der
betreffenden Fläche, sondern auch die am meisten abgekühlten
Gase entgegen wirken; er befindet sich vielmehr in einiger
Entfernung von der Berührungsfläche und, sofern die
Berührungsfläche die Wärme abgebenden Gase schachtförmig
umschließt, in der Mitte dieses Schachtes. In dieser Mitte
herrscht die höhere, an der Berührungsfläche eine wesentlich
niedrigere Temperatur.
Bewegen sich dagegen die Wärme abgebenden Gase abwärts, so sind
es die am meisten abgekühlten, welche vorzueilen suchen, während
die heißeren zurückbleiben – nicht aber wegen der
Widerstände, sondern auf Grund der natürlichen Ausgleichung der
Gewichte. In diesem Falle wird demnach die Oberflächenwärme in
ein und derselben wagrechten Ebene um weniger abweichen von der
Wärme der Luft in der Mitte des etwaigen Schachtes, und zwar
werden sich die beiden Temperaturen um so näher
stehen, je rascher sich die Gase bewegen, d.h. je enger der
Schacht ist.
Sobald die Rauchgase durch nahezu wagrechte Röhren strömen, wird
eine verschiedene Wärmeabgabe an der Umfläche derselben
stattfinden, entsprechend dem früher Gesagten. Die
Verschiedenheit wird noch dadurch verstärkt, daß die kältern
Gase die untern, die wärmeren dagegen die obere Fläche
berühren.
Endlich ist noch der Fall in Betracht zu ziehen, daß die Gase
durch Biegungen oder scharfe Kröpfungen u. dgl. ihrer Wege zu
lebhaften Wirbelungen veranlaßt werden. Es mischen sich dann
fortwährend die abgekühlten Gase mit den heißeren, so daß die
Berührungsfläche in rascher Weise mit neuen Wärmemengen versehen
wird.
Sobald die Wand Wärme abgeben soll, so sind die Vorgänge nach dem
vorhin Gesagten leicht entsprechend umzulegen.
Würde man nur das Bestreben haben, möglichst viel Wärme zu
übertragen, so würde man leicht die Wahl über die zweckmäßigste
Lage der Heizfläche treffen können. Man wünscht aber, so lange
die Gase sehr heiß sind, eine verhältnißmäßig langsame
Ueberführung der Wärme, um eine zu starke Erwärmung der
Heizflächen zu verhindern; man wünscht später eine möglichst
rasche Leitung, um an Oberfläche und Raum zu sparen. Bei einer
guten Verbrennung wird unter allen Umständen ein so hoher
Wärmegrad in dem Verbrennungsraum entstehen, daß gewöhnliche
Metallwände, die denselben unmittelbar einschließen, glühend
werden. Man hat hier besondere Mittel anzuwenden, um das
Erglühen zu verhüten.
Diese kurzen allgemeinen Betrachtungen mußten wir hier
einschalten, da wir uns bezüglich derselben auf keine
Veröffentlichung beziehen konnten, auch die Kenntniß der
allgemeinen Bedingungen für eine vortheilhafte Wärmeüberführung
noch nicht in so weite Kreise gedrungen ist, um sie als bekannt
voraussetzen zu dürfen.
Gehen wir nun zu der Besprechung der einzelnen Heizkörper in
Bezug auf deren Heizflächen über. Zunächst mag von den Verfahren
die Rede sein, das Erglühen der Wände zu verhüten.
Einige Feuerungseinrichtungen lassen keine besonderen
Vorkehrungen in dieser Hinsicht erkennen. So z.B. diejenige des
Ventilationskamms von Joh. Georg Bodemer in Zschopau, welchen die Figuren
53 bis 56 Taf.
III [c.d/2] wiedergeben. Der
Brennstoff stützt sich auf wagrechte Stäbe r (Fig. 53
und 54) und
lehnt sich theils an die von Luft durchströmten Röhren i, theils an die diese umschließende
gußeiserne Wand, welche in den Figuren
53 und 54
geschnitten zu sehen ist. Wenn nicht durch die große
Kaminöffnung so viel Luft einströmt, daß ein bedeutender
Luftüberschuß eintritt, so ist ein Erglühen der Röhren i und der bezeichneten Rückwand nicht zu
vermeiden, wenn auch durch Strahlung ein Theil der Wärme dem
Feuer entzogen und dem zu beheizenden Raume zugeführt wird.
Der Ofen zur Beheizung von Eisenbahnwagen, welcher von der
„Schweizerischen Industriegesellschaft“ in
Neuhausen ausgestellt war – ein niedriger Füllofen, in
einfachem Schacht bestehend – hat besonders dicke
Wandungen. Hierdurch ist ein Glühendwerden der Außenflächen des
Heizschachtes zu verhüten, wenn die Maßverhältnisse passend
gewählt werden.
An dieser Stelle müssen wir eines Mittels gedenken, welches sehr
geeignet ist, den in Rede stehenden Uebelstand zu heben. Bei dem
Bodemer'schen Kamin wurde darauf hingewiesen, daß durch
entsprechenden Ueberschuß von Luft die Temperatur des
Verbrennungsraumes genügend herabgedrückt werden könne, um eine
zu große Erwärmung der Heizflächen zu vermeiden. Dieses
Verfahren ist indessen nur zu rechtfertigen, wenn der
betreffende Luftüberschuß durch die verdorbene Luft des Zimmers
gebildet wird, die einer Erwärmung bedarf, um die erforderliche
Kraft zu ihrer Bewegung zu gewinnen. Soll dagegen die
entwickelte Wärme in erster Linie zur Erwärmung unter
Vermittlung der Ofenwände dienen, so ist jenes Verfahren nicht
zulässig. Man kann statt dessen eine rasche Abführung der Wärme,
also eine Herabdrückung der Temperatur im Feuerraum hervorrufen,
durch verhältnißmäßig große Wärme abgebende Flächen. Dies
scheint bei dem genannten Ofen der „Schweizerischen
Industriegesellschaft“ beabsichtigt zu sein, indem
der äußere Durchmesser des betreffenden Feuerschachtes im
Verhältniß zur Wärmeentwicklung ein sehr großer ist, wodurch der
günstige Einfluß der dicken Wandungen wesentlich unterstützt
wird.
In ausgeprägtester Weise ist von dem bezeichneten Verfahren
Gebrauch gemacht bei den ausgestellten amerikanischen Oefen,
welche bereits in diesem Journal (*1877 225 203)
ausführlich beschrieben und abgebildet sind. Wir machen auf die
Bauchform in Höhe des Feuerraumes besonders aufmerksam, welche
fast den dreifachen Durchmesser des Feuers hat (vgl. Fig. 76 S. 118). Sie führt große
Wärmemengen sofort ab, mindert dadurch also die Temperatur
entsprechend. Durch die eigenthümliche Anordnung des
Ofenobertheiles wird die in Rede stehende Oberfläche in
sinnreicher Weise vergrößert. Der Raum zwischen Kohlenschacht
und Ofenwand ist sehr eng, so daß die aufsteigenden heißen Gase
sich gradezu mischen müssen mit den niedersinkenden, bereits abgekühlten Gasen.
Fig. 76., Bd. 226, S. 118
Hierdurch wird die Trommelfläche des
Oberofens zur Abführung der Wärme herangezogen, bevor die
Gase an den Flächen vorbeistreifen, also ihre Wärme
unmittelbar übertragen. Bei diesem Vorgange im Oberofen
spielt noch die oben hervorgehobene, beim Aufsteigen der
Wärme abgebenden Gase eintretende Erscheinung eine gewisse
Rolle. Die Wand des Kohlenschachtes führt keine Wärme ab; an
ihrer Oberfläche können daher die Gase keine Abkühlung
erfahren, werden also hier emporsteigen, während, soweit
nicht die bereits erwähnte Mischung eintritt, die
abgekühlten Gase längs der innern Oberfläche
niedersinken.
Fig. 59., Bd. 226, S. 118
An diese Verfahren schließen sich zunächst die Versuche,
durch besondere Vergrößerung der sonst wie immer
ausgeführten Wandungen der Feuerstelle solche Wärmemengen
abzuführen, daß ein Glühendwerden derselben verhütet wird.
Dies geschieht durch Anbringen von Rippen auf der Wärme
abgebenden Oberfläche, welchem Verfahren unserer Ansicht
nach eine zu große Bedeutung beigelegt wird. Wir hatten
Gelegenheit, genaue vergleichende Versuche anzustellen
bezüglich der Wärmeabgabe lothrechter gußeiserner Röhren von
80mm innerem,
100mm äußerem
Durchmesser, mit glatten Wandungen sowohl, als auch mit
angegossenen Rippen, wie im Querschnitt Figur 59 zeigt.
Es ergab sich, daß trotz der
verhältnißmäßig günstigen Lage der Rippenflächen in Bezug
auf Strahlung die Wärmeabgabe des gerippten Rohres sich zu
derjenigen des glatten Rohres nur verhielt wie 25,8 : 16,3.
Sobald die Rippen fast parallel zu einander sind, wird
dieses Verhältniß ungünstiger sein, da sich die Flächen
gegenseitig bestrahlen. Trotzdem ist etwas zu erreichen, und
das Verfahren deshalb nicht zu verwerfen zum Zweck, die zu
große Erwärmung der Heizflächen zu verhüten.
Die ausgestellten Meidinger-Oefen sind nur durch das angegebene
Mittel geschützt, ebenso der Kammofen vom „Eisenwerk
Kaiserslautern“, Fig. 5
Taf. I [c/1], der Mantelofen von
Friedr. und John Röbbelen, Fig. 60 bis 62 (S. 124), der „Pfälzer-Ofen“,
Fig. 49 Taf. I [d/4]. Wir
wissen aus Beobachtungen – wenigstens soweit es den
Meidinger-Ofen betrifft – daß die Rippen nur so lange
gegen das Glühen schützen, als durch aufmerksames Behandeln
eine zu große Wärmeentwicklung verhütet wird.
Weibel, Briquet und Comp. (Fig. 38
bis 40 Taf. I
[a/4]) verbinden die gerippte, oder
besser gesagt gefaltete und gerippte Fläche mit dem Verfahren,
welches bei dem Ofen von Perry und
Comp. (Figur
76) in so glücklicher Weise angewendet ist, indem sie die
zunächst in Frage kommende Heizfläche sehr groß machen. Die
Wandung des Feuerraumes soll keine Wärme an die Luft abführen,
sie leitet dieselbe lediglich den bereits mehr oder weniger
abgekühlten Feuergasen des untern Theiles vom Ofen zu.
Ein anderer Theil der Wärme des Feuerraumes wird durch Strahlung
an die gefaltete und gerippte dachförmige Deckplatte des Ofens
abgegeben, gegen welche die durch erwähnte beide Vorgänge
entsprechend abgekühlten Feuergase zunächst stoßen; es muß als
Fehler bezeichnet werden, daß die Deckplatte die genannten
beiden Zwecke erfüllen soll, sowohl die strahlende Wärme des
Feuers, als auch die leitende Wärme der heißesten Gase so rasch
überzuführen, wie erforderlich ist, um ein Erglühen zu
verhindern. Ob die Deckplatte diesen Ansprüchen unter allen
Umständen zu genügen vermag, erscheint uns fraglich, wenngleich
wir dem sonstigen leitenden Gedanken dieser Anordnung unsere
Anerkennung nicht versagen können.
Blazicek (Fig. 9
Taf. I [b/4]) und Möhrlin (Fig. 10
und 11 Taf. I
[d/1]) leiten einen Theil der Wärme
des Feuerraumes derjenigen Luft zu, welche zur fernern Speisung
des Feuers dient. Hierdurch kann nur dann eine Abkühlung des
Feuerraumes stattfinden, wenn Luft im Ueberschuß zugeführt wird.
Ein Theil der Wärme wird durch Leitung, ein Theil durch
Strahlung der eigentlichen Ofenwandung, deren Oberfläche mit
Rippen versehen ist, zugeführt, und zwar offenbar in so milder
Weise, daß die Temperatur der Ofenoberfläche wahrscheinlich an
keiner Stelle über 500° steigen wird, sofern die Gase bis
zur Berührung mit weniger geschützten Flächen die erforderliche
Wärmemenge verloren haben. Dies scheint uns aber deshalb nicht
immer der Fall zu sein, weil bei Möhrlin sowohl, als auch bei Blazicek die Feuergase bald nach Verlassen des Feuerraumes
gegen Kanten l zu stoßen
Veranlassung haben, also dort eine lebhaftere Wärmeabgabe an die
betreffende Wand stattfindet, ohne daß dieselbe befähigt ist,
die aufgenommene Wärme entsprechend rasch abzugeben.
Das am meisten verbreitete Verfahren, die den Feuerraum
bildenden, bezieh. demselben zunächst liegenden Wände so
herzustellen, daß ihre der zu erwärmenden Luft zugekehrte
Oberfläche nicht überhitzt wird, besteht in dem
Verkleiden mit Mauerwerk und zwar, da die in Frage kommenden
Massen nur geringe sind, also der Preis keine Rolle spielt, mit
Chamottemauerwerk. Nur ist die Ausdehnung und die Art dieses
Mauerwerkes sehr verschieden.
Kniebandel und Wegener in Berlin haben an den beiden von ihnen
ausgestellten Oefen einen verhältnißmäßig großen liegenden
Feuerkasten angewendet. Die horizontale Kohlenrast nimmt kaum
ein Viertheil der Länge des genannten Kastens ein. Der Kasten
ist vollständig mit Chamottemauerwerk ausgefüttert, welches
– außer an den Ecken – an mehreren Stellen durch
Quermauern gestützt ist. Von der Rast aus bildet die erste
Querwand die Feuerbrücke, unter welcher eine große
Reinigungsöffnung ausgespart ist; die zweite und nach Umständen
die dritte Querwand sind mit zahlreichen Löchern versehen, um
die Rauchgase zu vertheilen, wie der Aussteller angab; die
letzte Querwand schließt oben dicht an die Decke, ist an sich
dicht und läßt über dem Boden einen breiten Spalt frei, durch
welchen die Rauchgase in die hintere Abtheilung des Feuerkastens
gelangen, der in seiner Decke zwei Oeffnungen zur Weiterleitung
der Gase hat. Der Kasten ist aus zusammengeschraubten, glatten
Gußeisenplatten gebildet. Der Kasten soll den Gasen einen
wesentlichen Theil der Wärme entziehen. Um dies zu sichern,
können nur die am wenigsten warmen Gase den Kasten verlassen.
Bis zu dem betreffenden Spalt werden aber die Gase zu vielfachen
Wirbelungen veranlaßt, so daß sie lebhaft an den Wänden
spülen.
Wir glauben, daß der beabsichtigte Zweck erreicht wird, und haben
nur das Bedenken – wie bei allen Chamotteauskleidungen
– daß häufige, nicht bequem sichtbare Ausbesserungen
erforderlich werden.
Emil Kelling hat den Feuerraum C, den Schacht D, den Vertheilungscanal E und
die obern Heizrohre F seines Ofens
(Fig. 45
bis 48 Taf.
III [a.c/4]) in abnehmender Stärke
mit Chamotte ausgefüttert. Ebenso Friedr. und John Röbbelen in dem Ofen, welchen die Figuren 73 bis 75 Taf.
III [b/2] darstellen. Der in Fig.
50 und 51 Taf. I
[c/3] skizzirte Ofen derselben
Aussteller ist bis zum Vertheilungscanal E mit Chamotte ausgekleidet.
Dieses Verfahren wird einem Erglühen bestimmt vorbeugen, wenn es
gelingt, die Auskleidung gleichförmig und sicher an den
Wandungen zu befestigen, was uns aber, so weit es den Canal E und die Röhren F betrifft, schwierig zu sein scheint. Man kann zu
einzelnen Stellen nur schwer gelangen, oder doch wenigstens
dieselben nicht auf die Güte der Ausführung prüfen. Außerdem
müssen wir das Bedenken hegen, daß entweder durch ungeschickte
Handhabung der Putzbürste, oder durch die verschiedene
Ausdehnung von Stein und Metall, oder durch beides
gemeinschaftlich, die Auskleidung abgelöst und so die
betreffenden Wandflächen entblöst werden, ohne daß eine
Möglichkeit vorläge, den Zustand bequem zu erkennen.
Viele der ausgestellten Oefen sind in weit geringerer Ausdehnung
ausgefüttert. So der große Ofen von Krigar und Ihssen (Fig.
19 bis 22 Taf.
II [a.c/1]), bei welchem nur der
aufrechte Heizschacht an seinen Umfassungswänden und seiner
Decke mit Mauerwerk geschützt ist. Der obere Vertheilungscanal
f ist an seiner obern, dem Erglühen
zunächst ausgesetzten Fläche dadurch an unangenehmen Einfluß auf
die erwärmte Luft gehindert, daß dieselbe mit einer
Sandschüttung – in Figur 19
im Durchnitt sichtbar – bedeckt ist. Wenn dieser Schutz
hier nicht in so ausgedehntem Maße vorhanden ist als bei Kelling und Röbbelen, so ist er leichter nachzusehen und
auszubessern.
Reinhardt's Ofen (Fig. 34
bis 37 Taf.
II [b.c/3]) ist nur in seinem
Feuerschacht C ausgemauert; der Hals
D und das Vertheilungsrohr E sind in starkem Eisen gegossen und mit
Rippen versehen, wie es auch bei den Heizrohren F an deren oben liegenden Hälfte der
Fall ist.
Wenn wir bei den Krigar und Ihssen'schen Oefen die Rippen bis jetzt
nicht genannt haben, so geschah dies, weil wir nicht besorgten,
dieselben würden für den ihnen zufallenden Antheil an der hier
in Rede stehenden Wirkung ungenügend sein.
Bei dem Reinhardt'schen großen Ofen
müssen dagegen die Rippen hervorgehoben werden, da denselben
augenscheinlich eine große Aufgabe gestellt ist, indem die
verhältnißmäßig wenig abgekühlten Gase an den krummen Flächen
des Halses D und des
Vertheilungsrohres E lebhaft spülen,
und außerdem die Decke von D die
Strahlung des Feuers auszuhalten hat. Es soll daher in einzelnen
Fällen diese gewölbte Decke – trotz der Rippen –
bis zum Glühen erwärmt worden sein.
Vergleichen wir hiermit den sogen. Schachtofen von Kaiserslautern
(Fig. 1 und 2 Taf. I
[a/1]), so müssen wir denselben als
günstiger gestaltet bezeichnen. Zunächst ist die Decke von D in verhältnißmäßig größerer Höhe über
dem Feuer angebracht, die strahlende Wärme des letztern also
nicht so einflußreich. Ferner ist die Fläche, längs welcher die
Feuergase strömen, bevor sie die Decke erreichen, im Verhältniß
größer. Diese Fläche liegt aber, bis auf die – in unserer
Figur 1 – rechts liegenden Kanten des
Zwischenstückes E, günstiger als die
betreffenden Flächen des Reinhardt'schen Ofens. Wie früher des
Weitern aus einander gesetzt wurde, findet eine abwärts
gerichtete Strömung an der Innenfläche des Feuerschachtes statt,
welche allerdings von der Strömung der Feuergase fortwährend
gestört wird. Diese niederwärts gerichtete Strömung wirkt
entschieden schützend auf die Flächen, zumal dieselben glatt
sind. Nur sind wir besorgt, ob der Flächentheil i des Ofenstückes D hierdurch genügend geschützt wird, um so mehr als die
Wärmeabführung von der Außenfläche von i bei etwas gehemmter Luftbewegung keine günstige genannt
werden kann.
Der Musgrave'sche Ofen (Fig.
8 Taf. I [b.c/1]) ist in
seinem Füll- und Feuerschacht ausgefüttert. So lange das Feuer
bei der Rast brennt, wie in der Skizze angegeben, wird die
Ausfütterung genügen. Brennt indessen das Feuer auf dem
Brennstoff in lebhafter Weise – was leicht eintreten
kann, wenn man gasende Kohlen verwendet – so dürften
sowohl der bewegliche Deckel c, als
auch die feste Decke d zu stark
erhitzt werden.
Die große Zahl der mit Halbfüllfeuerung ausgestatteten Oefen der
Ausstellung ist in der Weise ausgemauert, oder mit besonders
geformten Steinen ausgesetzt, wie es aus den Figuren
23 bis 33 Taf.
II an den von Krigar und Ihssen ausgestellten Oefen der Fall ist.
Man findet es hier genügend, nur den eigentlichen Feuerkasten,
höchstens aber noch einen kurzen Theil des diesem folgenden
Heizcanales auszufüttern. Auch der große, von der
„Berliner Actiengesellschaft für Central-Heizungs,
Wasser- und Gasanlagen“ ausgestellte blecherne Ofen,
dessen Feuerung der Meidinger'schen sehr ähnlich ist, sowie der
große, mit vier Feuerungen versehene Kirchenofen von Schuldt in Altona zeigen Ausfütterung
ähnlicher Beschränkung.
Es ist anzunehmen, daß dieser Schutz genügt, da bei kleinen
Feuerungen die Umfläche, also die Wärme abgebende Fläche des
Feuerraumes verhältnißmäßig größer zu sein pflegt als bei
größeren, daher die entwickelte Wärme mehr Gelegenheit hat,
durch die verkleideten Wände in genügender Menge zu
entweichen.
Interessant, und vielleicht einer weitern Ausbildung fähig, ist
der in einer Kelling'schen
Ofenzeichnung hervortretende Gedanke, die heißen Rauchgase durch
einen Wasserkessel streichen zu lassen, um ihnen hier einen
Theil ihrer Wärme zu nehmen.
Bevor wir zur Besprechung des durchschlagendsten Mittels
übergehen, eine nur mäßige Temperatur der Wärme abgebenden
Fläche zu gestatten – wir meinen die Wasser- und
Dampfheizungen – wollen wir die Heizflächen in Bezug auf
ihre Wärmeabgabe an die Luft besprechen.
Die Wirksamkeit der Flächen in ihren verschiedenen Lagen und
ihrer Benutzungsart ist früher allgemein behandelt, so daß wir
hier, da von einem Erglühen der Wände nicht mehr die Rede ist,
ohne weiters den Satz aussprechen dürfen: „Es sollen
die Wände so gelegt werden, daß der Rauch bequem nach unten
sinken, die erwärmte Luft ungehindert nach oben sich bewegen
kann, so weit nicht besondere Verhältnisse ein Anderes
nothwendig machen.“ Da, abgesehen von der
Wirkungsweise der Heizflächen, die Abführung des Rauches am
niedrigsten Punkte des Ofens zweckmäßig ist, so ist zu erwarten,
daß jene Abwärtsführung des Rauches in der Regel angewendet
wird.
In dieser Hinsicht zeichnen sich aus, die großen Oefen vom
„Eisenwerk Kaiserslautern“ (Fig. 1 und
2 Taf. I [a/1]), von Weibel, Briquet und Comp. (Fig. 38
bis 42 Taf. I
[a/3]) und von Krigar und Ihssen (Fig.
19 bis 22 Taf.
II [a.c/1]). Der Kaiserslautener,
wie auch der Krigar und Ihssen'sche Ofen haben nur einen
Bruchtheil ungünstig liegender Flächen; bei dem Weibel und
Briquet'schen Ofen ist die einzige ungünstige Fläche der
Ofenboden i.
Der Ofen von Möhrlin (Fig. 10
und 11 Taf. I
[d/1]) erscheint in der betrachteten
Richtung ebenfalls zweckmäßig angeordnet. Der durch den
wagrechten Hals D strömende Rauch
vertheilt sich im Kasten E auf die
vier Schächte F, sinkt in diesen
nieder und entweicht bei i nach dem
Schornstein. Die Luft macht den entgegengesetzten Weg; sie kann
aber, so weit sie innerhalb der vier Schächte F emporstieg, oben nur schwer
entweichen. Warum ist der Kasten E
nicht ebenso wie der Unterkasten G
in der Mitte durchbrochen, um der Luft einen angemessenen Weg zu
bieten?
Weniger günstig, aber noch im Sinne der obigen Gesetze
angeordnet, sind die Röhrenheizflächen des Reinhardt'schen großen Ofens (Fig. 34
und 37 Taf.
II [b.c/3]), des Kelling'schen Ofens (Fig. 45
bis 48 Taf.
III [a.c/4]) und des nur in
Zeichnung ausgestellten Röbbelen'schen Ofens (Fig. 73
bis 75 Taf.
III [b/2]). Die liegenden Röhren
dieser Oefen können ihre Flächen nicht vollständig verwerthen,
indem der untere Bogen derselben verhältnißmäßig wenig Wärme
zugeführt erhält und – bei Reinhardt und bei Kelling
– auch nur im geringen Maße von der zu erwärmenden Luft
bespült werden kann.
Mangelhafter ist die Röhrenanordnung bei den großen Oefen von Kniebandel und Wegner, welche nicht allein an dem genannten Uebelstande
leiden, sondern durch welche die Rauchgase nach oben steigend
strömen. Der Grund dieser als fehlerhaft zu bezeichnenden
Anordnung ist in dem Raumerforderniß des Feuerkastens zu finden,
welcher, wie früher angegeben, sehr vortheilhaft in
Bezug auf Verhütung des Erglühens der Wandungen, aber deshalb
sehr groß ist. Wollte man die Heizröhren in absteigender Folge
legen, so würde der ganze Ofen ziemliche Breite erfordern.
Oefen für Sammelheizungen lassen sich im allgemeinen leichter
nach den Forderungen der Zweckmäßigkeit in Bezug auf die einem
Ofen eigentlich zu stellende Aufgabe anordnen, als es bei
Einzelheizungen der Fall ist. Bei letztern spielen Raumersparniß
und geschmackvolle Formen eine solche Rolle, daß vielfach nicht
die einfachen Regeln angewendet werden können. Um so mehr ist es
anzuerkennen, wenn wenigstens Bemühungen vorliegen, die
letztgenannten möglichst geltend zu machen.
In dieser Hinsicht haben wir des größten Theiles der Oefen mit
Halbfüllfeuerung zu gedenken, deren Heizflächen entweder in der
Weise angeordnet sind, wie die Figuren
29 bis 31 Taf.
II [d/1] erkennen lassen, oder in
der Art auf einander folgen, wie die Figuren
13 und 14 Taf. I
[b/4] zeigen. Die erstere
zweckmäßigere, aber nur bei Oefen einiger Größe anwendbare
Anordnung besteht darin, daß die Rauchgase in dem Schacht B (Fig. 29
und 31) empor
steigen, oben durch zwei schmale Canäle an dem Luftschacht C vorbeiziehen und nunmehr in abwärts
gehender Richtung D durchstreichen,
um die zum Schornstein führende Oeffnung E zu erreichen. Die andere in Fig. 13
und 14
wiedergegebene Art ist insofern unvollkommener, als die zwischen
B und D
befindliche Scheidewand für die Wärmeabgabe werthlos ist.
Fig. 60., Bd. 226, S. 124
Fig. 61., Bd. 226, S. 124
Fig. 62., Bd. 226, S. 124
In ähnlicher Weise findet die Rauchführung im Röbbelen'schen Ofen (Fig. 60 bis 62) statt. Der Rauch steigt von der Feuerstelle A aus in dem Mittelschacht B empor, überschreitet die B von D, D
trennenden Wände und steigt durch die beiden Schächte D hinab in den Raum, von welchem er
durch die Oeffnung E in den
Schornstein gelangt.
Neben der sinnreichen Anordnung der Heizungsflächen des Ofens von
Perry und Comp. von welcher oben schon mehrfach die Rede war, nennen
wir hier als bemerkenswerth die von Krigar und Ihssen an mehreren
ihrer Oefen angewendete Art, welche aus den Figuren
23 bis 28, 32 und 33 Taf.
II zu erkennen ist. Die Feuergase steigen von dem Raum A in den Heizschacht B. Da – wie früher hervorgehoben
wurde – die heißesten Gase in der Mitte von B emporsteigen, während die Heizflächen
durch niederfallende, abgekühlte Gase gewissermaßen lahm gelegt
werden, sofern beide Strömungen nicht nahe genug geführt werden,
um Wirbelungen zu veranlassen, so haben die Hersteller den
Schacht B durch eine Platte
geschlossen, durch welche die Rauchgase nur vermöge der Röhren
C, die in der Nähe der Heizflächen
liegen, nach D entweichen können.
Hierdurch werden die heißen Gase gezwungen, sich im obern Theil
von B den Wandungen mehr zu nähern,
also eine lebhaftere Erwärmung derselben zu veranlassen, während
die Wandungen des untern Theiles von B durch die weniger in ihrer abwärts gerichteten Bewegung
gestörten Gase gegen zu starke Erwärmung geschützt werden.
Wir erinnern daran, über ein ähnliches Bestreben in diesem
Journal, 1876 222 5 berichtet zu
haben.
Die genannte Wirkung würde erreicht werden durch das Anbringen
von Löchern. Es ist daher der Grund für die Verwendung von
Röhren C noch zu nennen. Derselbe
dürfte darin zu finden sein, daß man in der Höhe von C eine lebhafte Wirbelung der Heizgase
veranlassen will. Indem die Gase mit einer gewissen
Geschwindigkeit den Röhren C
zuströmen, werden gewisse Mengen an C vorbeistreifen, sich an der Platte stoßen und so den
beabsichtigten Zweck erfüllen. Von D
aus wird der Rauch nach E
zusammengezogen, was abermals zu Wirbelungen Veranlassung gibt.
Dieser Anordnung ist jedenfalls, wie seiner Zeit der in Bd. 222
S. 5 erwähnten, der Vorwurf einer verhältnißmäßig unbequemen
Reinigung zu machen.
Dies ist noch in höherem Maße der Fall bei dem in Zeichnung
ausgestellten Ofen von Ladislaus Fescl in Budapest, in welchem die Wirbelungen
hervorgerufen werden durch abwechselnd rechts und links in dem
aufrechten Heizrohr angebrachte wagrechte Platten, die nur einen
Theil des Rohrquerschnittes freilassen. Der genannte Ofen hat
die Nachtheile, aber nicht die Vortheile des sog. Etagen- oder
Durchsichtsofens.
Eine eigenthümliche Anordnung zeigt ein hübscher Ofen von Geiseler in Berlin. Der unten
ausgemauerte, trommelförmige Schacht ist oben durch eine
Halbkugel geschlossen. Seitwärts, etwa 200mm unter dem Mittelpunkt
der Halbkugel, entweicht der Rauch direct in den Schornstein.
Die Einrichtung erinnert an ältere Kanonenöfen, sowie an den
Ofen von Gurney (1876 222 5).
Blaziceck (Fig. 9
Taf. I [b/4]) sucht den Rauchgasen
die Wärme dadurch zu entziehen, daß er sie schließlich durch
einen aus Röhren gebildeten, mit vielen Winkeln versehenen Kopf
D führt.
Meidinger und jene Aussteller, welche
seine Oefen nachbauen, begnügen sich mit der Wärmeabgabe, welche
in dem eigentlichen Heizschacht stattfindet, indem sie den Rauch
aus dem obern Theile desselben ohne weiters abführen. Aehnlich
ist es bei dem Pfälzer Ofen, Fig. 49
Taf. I [d/4]. Diese Art genügt, so
lange eine mäßige Wärmeentwicklung, also eine mittlere
Verbrennung stattfindet. Bei heftigem Feuer entweichen die
Feuergase wenig ausgenutzt in den Schornstein.
Einige Worte verdient noch die Anbringung von Rippen an der
Heizoberfläche, behufs Vergrößerung derselben. Bei Besprechung
der Verfahren, das Erglühen der Wände unmöglich zu machen, hoben
wir schon hervor, daß der Erfolg der Rippen nur ein mäßiger
sei.
Berechnet man nach den günstigen Verhältnissen der Figur 59 S. 118 die erforderliche
Eisenmenge für das gerippte und für das glatte Rohr und
vergleicht damit das Verhältniß der Wärmeabgabe, welches wir
weiter oben nannten, so kommt man zu dem Ergebniß, daß eine
größere Eisenmenge erforderlich ist, um eine gewisse Wärmemenge
zu übertragen bei Anwendung des gerippten Rohres, als bei
Anwendung des glatten Rohres. Wie vielmehr wird dies der Fall
sein, wenn die Rippen gleichlaufend, oder gar wenn dieselben
angeschraubt sind, wie es die Wasserheizungs-Rippenrohröfen der
„Berliner Actiengesellschaft für Centralheizungs-,
Wasser- und Gasanlagen“ zeigten! Der angegebene
Beweggrund für diese Anordnung, eine Möglichkeit zur
Ausgleichung von „Rechenfehlern“ zu haben,
scheint uns der Sache würdig zu sein.
Immerhin ist die Anbringung von Rippen, obgleich sie keine
Ersparung zur Folge hat, in einzelnen Fällen gerechtfertigt,
wenn nämlich im kleinen Raum eine recht große Heizfläche
angebracht werden soll, oder wenn – aus
Gesundheitsrücksichten – die Wärme der Heizflächen eine
möglichst geringe sein soll, wobei wir ausdrücklich daran
erinnern, daß der Werth der Rippen für die Außenflächen der
Heizkasten nebst Zubehör früher besprochen ist.
Die Anwendung der gerippten Oberflächen an verschiedenen Oefen
ist
in den diesem Berichte beigegebenen Figuren genügend zu
erkennen. Wir machen nur noch darauf aufmerksam, daß Krigar und Ihssen die Rippen etwas gegen die lothrechte Linie neigen
und in einzelnen Stücken anordnen, wie aus der linken Hälfte der
Figur 21 Taf. II [b/1] zu
sehen ist, während Musgrave und Comp. die Rippen zwar auch in geneigten
Linien anbringen, aber sie ununterbrochen über die Oberflächen
hinweggehen lassen. Man beabsichtigt durch diese geneigte Lage
ein Wirbeln der Luft längs der Heizflächen hervorzubringen. Wenn
dies bei der Krigar und Ihssen'schen Anordnung Aussicht hat,
verwirklicht zu werden, so ist es doch wenigstens die
Musgrave'sche Art ohne Erfolg.
Wir haben noch das Verfahren zu nennen, welches bei
ausschließlich steigenden Rauchwegen durch möglichste Länge
dieser Wege eine möglichst vollkommene Wärmeüberführung
anstrebt. Die schon angeführten Durchsichtsöfen gehören hierher,
ebenso der Kaminofen vom „Eisenwerk
Kaiserslautern“ (Fig. 4 und
5 Taf. I [b.c/1]) und der
Kamin von Bodemer (Fig. 53
bis 56 Taf.
III [c.d/2]). Die beiden
letztgenannten Oefen sind offenbar, so weit es die Heizflächen
betrifft, unter dem zwingendem Einflusse der äußern Form
entstanden, weshalb keine zu hohen Forderungen in anderer
Richtung gestellt werden dürfen.
Der Wolpert'sche Centralheizungsofen,
welcher durch das „Eisenwerk
Kaiserslautern“ ausgestellt war, ist in seiner
hintern Abtheilung hauptsächlich aus aufrechten Röhren von
eiförmigem Querschnitt gebildet, welche trommelartig
zusammengestellt sind. Damit sich diese Röhren nicht gegenseitig
nutzlos bestrahlen, sind zwischen dieselben Bleche gestellt,
welche die strahlende Wärme aufnehmen und durch Leitung an die
vorbeistreichende Luft abgeben.
Unseres Wissens ist diese gewiß beachtungswerthe Art, die
Strahlung für die Erwärmung der Luft nutzbar zu machen, zuerst
von Wiman Vgl. Zeitschrift des Vereines
deutscher Ingenieure, 1871 Bd. 15 S. 679., in
Stockholm angewendet. – Sollte Dr. Wolpert schon vor 1868 jene
Anordnung getroffen haben, so bitten wir um Berichtigung.
– Sie hat Verwandschaft mit den Ummantelungen der Oefen,
namentlich der von Meidinger
angewendeten doppelten Ummantelung, die ebenfalls zu einer
zweckmäßigen Erweiterung der Wärme ableitenden Flächen
führt.
Wir beabsichtigten, eine Vergleichung der Rastflächen mit den
zugehörigen Heizflächen vorzunehmen, mußten aber hiervon
abstehen, theils weil es nicht möglich war, einigermaßen genaue
Maße zu erhalten – in der Ausstellung durfte natürlich weder
gemessen, noch gezeichnet werden – theils weil die
Heizflächen ihrer verschiedenen Lage nach zu ungleichwerthig
sind, und weil ebenso die Ansprüche, welche an die Leistung der
Rastflächen gestellt werden, zu sehr wechseln.
Wenn die Ansprüche an die Reinhaltung der Heizflächen bei
Zimmeröfen nicht sehr streng sein können, weil die Zugangswege
zum Innern der Rauchwege meistens so eng ausfallen, daß nur der
geschickte Arm eines Ofenreinigers hindurchzuschlüpfen vermag,
und die Oberfläche des Ofens gewöhnlich dem Auge zugänglich
genug ist, um zur Reinigung aufzufordern, so ist von den Oefen
für Sammelheizungen zu verlangen, daß sie bequem an den Innen-
und an den Außenflächen gereinigt werden können.
Was zunächst die Reinigung der Feuerseite, also das
„Ruhen“ anbetrifft, so ist besonders noch
die Forderung zu stellen, daß behufs derselben die Heizkammer
nicht betreten werden darf. Die betreffenden Gegenstände der
Brüsseler Ausstellung 1876 (vgl. Bd. 222 S. 4) gaben
Veranlassung zu tadelnder Bemerkung. Von den Sammelheizungsöfen
der Casseler Ausstellung war nur einer so unzweckmäßig
eingerichtet, daß nicht einmal die nothwendigste Rußung ohne
Besteigung der Heizkammer vorgenommen werden kann. Wir erwähnen
dieses Ofens daher weiter nicht und beginnen mit dem in dieser
Hinsicht nächst unbequemsten Ofen, um mit dem zweckmäßigsten zu
schließen.
Es ist zunächst der Ofen von Möhrlin
(Fig. 10
und 11 Taf. I
[d/1]) zu nennen. Der Schacht, in
welchem die Feuergase direct aufsteigen, bedarf keiner Rußung.
Das Rohr D ist leicht nach Wegnahme
der Deckel h₁ und d zu putzen. Die vollständige Reinigung
des Kastens E ist unmöglich, wenn
nicht dessen Deckel abgenommen wird; dasselbe gilt von den
Schächten F und dem Sammelkasten G, obgleich dieser durch das Rohr H₂ zugänglich gemacht ist. Diese
sämmtlichen Ofentheile sind nur mit Hilfe einer Bürste, welche
an einen biegsamen Stab gebunden ist, einigermaßen – gut
niemals – zu reinigen. Von einem Nachsehen, in welchem
Maße die Reinigung gelungen ist, kann gar nicht die Rede
sein.
Die beiden wagrechten Canäle des großen Ofens von Krigar und Ihssen (Fig. 19
bis 22 Taf.
II [a.c/1]) lassen sich einigermaßen
bequem putzen, die sämmtlichen aufrechten Kasten oder
„Flaschen“ dagegen in befriedigender Weise
nur nach Wegnahme der Deckel des obern wagrechten Canales, also
nach Betreten der Heizkammer seitens des betreffenden Arbeiters.
Unseres Wissens soll daher auf das Rußen dieser Flaschen
verzichtet werden.
Die Canäle und Röhren des Kelling'schen Ofens (Fig. 45
und 48 Taf.
III [a.c/4]) sind nach Wegnahme der
betreffenden Reinigungsdeckel bequem zu reinigen, bis auf die
Verbindungsstutzen, zu welchen man theilweise nicht gelangen
kann; sie sind auch unter Zuhilfenahme eines an eine Stange
gebundenen Lichtes auf ihre Reinheit zu prüfen.
Die Röhren und kastenförmigen Theile der Oefen von Reinhardt (Fig. 34
bis 37 Taf.
II [b.c/3]), von Röbbelen (Fig. 73
bis 75 Taf.
III [b/2]) und von Kniebandel und Wegener sind insofern vortheilhafter in Bezug auf das
Putzen, als alle Theile mittels einer Bürste oder Kratze, welche
an biegsamer Stange steckt, zu reinigen sind; die Prüfung der
Reinheit ist aber nur in beschränktem Maße möglich, weil jede
der Putzöffnungen mit zwei Röhren hosenförmig verbunden ist.
– Sollte nicht zu befürchten sein, daß bei dem Reinigen
die Auskleidung der Kelling'schen und Röbbelen'schen Röhren
beschädigt wird?
Wenn wir den Ofen von Weibel, Briquet
und Comp. (Fig. 38
bis 42 Taf. I
[a/3]) erst hier folgen lassen, so
mag mancher der Leser uns tadeln; wir glauben mit Unrecht. Die
Feuerthür p ist so groß gewählt, daß
ein nicht zu starker Schornsteinfeger hindurchschlüpfen und, auf
der Rast stehend, sämmtliche Flächen sehen, mit dem Besen
erreichen und reinigen kann, worauf der abgekehrte Ruß durch die
Putzöffnungen s entfernt wird. So
lange der Ofen dicht ist, so lange kann bei dieser Arbeit kein
Ruß in die Heizkammer dringen. Indessen sind zwei Mängel zu
nennen, von denen der eine zu beseitigen, der andere mit der
genannten Rußungsart verwachsen ist; der erstere besteht in der
Schwierigkeit, die beiden Rauchrohre I (Fig. 39
und 40),
welche anders angeordnet werden sollten, zu reinigen, der andere
in der Nothwendigkeit, den Ofen vor der Reinigung kalt werden zu
lassen. Jede Reinigung bedingt daher eine immerhin nennenswerthe
Unterbrechung der Heizung.
Anders ist dies bei der Rußung des Kaiserslautener Schachtofens (Fig. 1 und
2 Taf. I [a/1]); derselbe
kann bequem und sicher gereinigt werden unmittelbar nach dem
Verlöschen des Feuers. Nach Wegnahme der beiden Deckel P sind sämmtliche Flächen – mit
nicht nennenswerther Ausnahme – zu erreichen, ohne Hilfe
künstlicher Werkzeuge; nach Wegnahme des Deckels Q läßt sich eine Lampe im Sammelkopf F aufstellen, welche bei passender
Verschiebung sämmtliche Flächen genügend beleuchtet, um sie auf
ihre Reinheit zu prüfen. Diese Oefen können daher in Bezug auf
Entrußung als die besten bezeichnet werden.
Der Reinigung der Zimmeröfen haben wir schon mit einigen Worten
gedacht; sie ist unvermeidlich die Quelle vielen Schmutzes. Aber
selbst das Nothwendige in Bezug auf unbequeme Entrußung wird
nicht selten überschritten, wovon der Blazicek'sche Ofen (Fig. 9
Taf. I [b/4]) und der Röbbelen'sche Mantelofen (Fig. 50
und 51 Taf. I
[c/3]) zeugen. Wie will man den
zusammengesetzten Kopf D Figur
9 reinigen, wie die Rohre F
des in Figur 51
dargestellten Ofens?
Es sind dies nur Beispiele; leider bot die Ausstellung in dieser
Richtung viel Aehnliches.
Die Reinigung der Ofenaußenflächen von Staub ist auch für die am
wenigsten erwärmten Heizflächen von Wichtigkeit. Man braucht
nicht immer an das Verbrennen des Staubes zu denken; jede
lebhafte Erwärmung befördert die natürliche Zersetzung der
Staubtheile und entwickelt dadurch Luft verunreinigende Gase.
Deshalb soll die Staubablagerung auf den Ofentheilen durch die
Ofenform möglichst hintertrieben werden. Es ist demnach dafür zu
sorgen, daß möglichst wenige obere wagrechte Flächen vorhanden
sind, und daß die aufrechten Flächen keine annähernd wagrechten
Vorsprünge enthalten. Man wird bemerken, daß diese Forderungen
den Regeln für die zweckmäßige Lage und Form der Heizflächen in
Bezug auf die Wärmeübertragung durchaus nicht widersprechen.
Die Form der mehrfach angezogenen Oefen für Sammelheizungen
verstößt leider vielfach gegen die genannten Grundsätze. Der
breite Rücken des Kniebandl und Wegener'schen Feuerkastens, die gefaltete
Deckplatte des Ofens von Weibel,
Briquet und Comp. (Fig.
38 und 40 Taf. I
[a/3]), die liegenden Heizrohre
verschiedener Oefen und die Querrippen auf dem Rücken des Reinhardt'schen Ofenhalses D (Fig. 36
Taf. II [c/3] sind abschreckende
Beispiele. Wenn die Möglichkeit gegeben ist, die betreffenden
Flächen bequem zu reinigen, wie bei Kelling (Fig. 45
bis 48 Taf.
III [a.c/4]), bei Möhrlin (Fig. 10
und 11 Taf. I
[d/1]) und namentlich bei Krigar und Ihssen (Fig. 19
bis 22 Taf.
II [a.c/1]), so sind größere
Staubablagerungsflächen eher zulässig.
Am günstigsten stellen sich hier wieder die Kaiserslautener Oefen (Fig. 1 und
2 Taf. I [a/1]) dar, welche
verhältnißmäßig die kleinsten Staubflächen haben, und an denen
auch die überwiegenden aufrechten Flächen ohne Schwierigkeiten
gereinigt werden können.
(Schluß
folgt.)