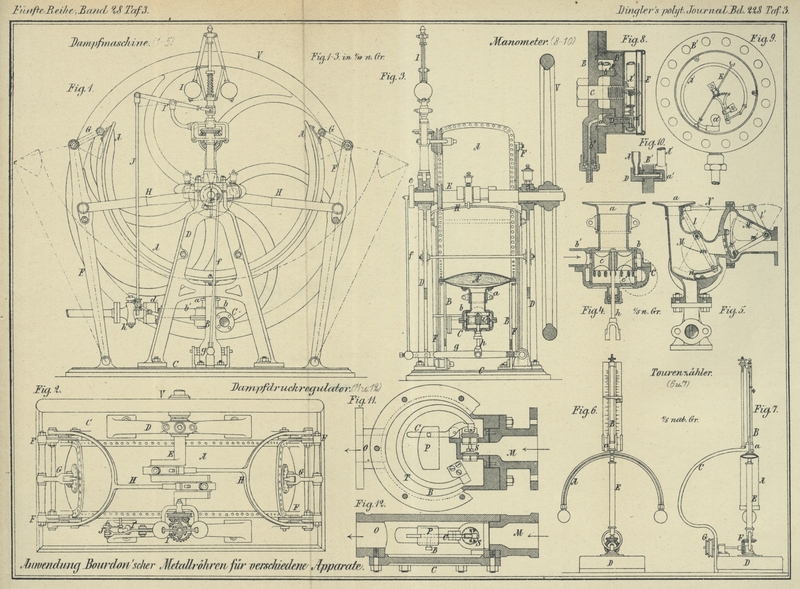| Titel: | Anwendung des Principes der Eugen Bourdon'schen gekrümmten Metallröhren von nicht kreisförmigem Querschnitt auf verschiedene Apparate. |
| Autor: | A. P. |
| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 26 |
| Download: | XML |
Anwendung des Principes der Eugen Bourdon'schen
gekrümmten Metallröhren von nicht kreisförmigem Querschnitt auf verschiedene
Apparate.
Mit Abbildungen auf Tafel
3.
Bourdon's Metallröhren für verschiedene Apparate.
Längst bekannt und viel verbreitet sind jene Manometer und Metallbarometer, deren
Hauptorgan eine gekrümmte elastisch-biegsame Metallröhre von nicht kreisförmigem
Querschnitt bildet. Weniger bekannt jedoch dürfte es sein, daſs der Erfinder, Eugen Bourdon, seine Röhren noch auf eine Menge anderer
Instrumente und Maschinen in Anwendung zu bringen gewuſst hat, bei denen entweder
die Aenderung der Krümmung oder des Rauminhaltes oder beides zugleich
zweckentsprechend verwerthet ist. Wir entnehmen einer in Armengaud's
Publication industrielle, 1877 Bd. 24 S. 161
erschienenen umfangreichen Abhandlung die Beschreibung einiger der bemerkenswerthesten Anwendungen des in
Rede stehenden Principes, ohne jedoch in der Lage zu sein, über den praktischen
Erfolg derselben Näheres berichten zu können.
1) Dampfmaschine mit elastisch-biegsamer Röhre (Fig. 1 bis 5 Taf. 3). Fig. 1 und 2 stellen
diesen Motor in der äuſseren Ansicht und im Grundrisse dar. Fig. 3 ist ein Querschnitt
durch die Kurbelwelle. Obgleich vorliegendes System für den Dampfbetrieb bestimmt
ist, so können doch Fälle eintreten, wo der Betrieb mit comprimirter Luft ebenso gut
anwendbar und vorzuziehen ist. Bourdon hat deshalb bei
seinen Maschinen zweierlei Vertheilungssysteme (innere Steuerungen) eingeführt,
nämlich für den Dampfbetrieb den in Fig. 4 nach einem
gröſseren Maſsstabe dargestellten „Hohlkolbenschieber“, für den Betrieb mit
comprimirter Luft die in Fig. 5 im
Verticaldurchschnitt abgebildete „Abwicklungsklappe“ (tiroir à
déroulement). Erwägt man, daſs bei seinem bekannten Manometer die gekrümmte
Metallröhre, von welcher die Bewegung des Zeigers abhängt, in eine Curve von
gröſserem Krümmungshalbmesser übergeht, wenn sie mit einem Raum in Verbindung steht,
welcher Dampf von gewisser Spannung oder comprimirte Luft enthält, dagegen vermöge
ihrer Elasticität ihre ursprüngliche Krümmung wieder annimmt, sobald der Dampf- oder
Luftdruck aufhört, so ist leicht einzusehen, wie bei dem vorliegenden System die
Kolbenbewegung durch das Spiel der biegsamen Röhre ersetzt werden kann.
Das Hauptorgan der Maschine ist die biegsame Röhre A,
welche in ihrer Mitte auf zwei an die Bodenplatte C
befestigten eisernen Trägern B festgeschraubt ist. Mit
der nämlichen Bodenplatte sind die beiden guſseisernen Ständer D der doppeltgekröpften Welle E verbunden, desgleichen die Lager der vier Hebel F, welche durch die gabelförmigen Schubstangen H mit der Antriebwelle E und durch die
Gelenke G mit den Enden der Röhre A verbunden sind. Die Röhre besteht hier aus zwei
ungefähr 1mm,5 dicken, kreisförmig gebogenen und
mit ihren Rändern zusammengenieteten Stahlblechbändern. An ihrer tiefsten Stelle und
in der Mitte ihrer Breite steht sie durch einen kurzen Rohransatz a (Fig. 3 und 4) mit der cylindrischen
Kammer b in Verbindung, welche den Dampfschieber c umschlieſst. Der Dampf strömt durch das Rohr b' in die Ventilkammer, und das mit dem Regulator I in Verbindung stehende Drosselventil d regulirt den Dampf zutritt. Sobald nun der dicht vor
dem letzteren angeordnete Hahn K geöffnet wird, strömt
der Dampf in die elastische Röhre A. Dem inneren Drucke
nachgebend, bläht sich diese leicht auf; dadurch entfernen sich die beiden Enden von
einander und stoſsen die beiden Hebel F rechts und
links mit Gewalt zurück. Die Schubstangen H
übertragen diesen Impuls
auf die gekröpfte Welle E und bewirken dadurch eine
halbe Umdrehung des Schwungrades V. In diesem Momente
ändert der Dampfschieber, dessen Bewegung durch Vermittlung der Stange f und des Hebels g mit der
Umdrehung der Kurbel e zusammenhängt, seine Stellung
und die Ausströmungsöffnung wird frei. Der Dampf, welcher die beiden Schenkel der
elastischen Röhre ausgestreckt hielt, entweicht nun durch das Ausströmungsrohr C, die Enden der Röhre, welche vermöge ihrer
vollkommenen Elasticität ihrer ursprünglichen Krümmung wieder zustrebt, nähern sich
wieder einander, indem sie die Schubstangen H nach sich
ziehen, und das Schwungrad vollendet, diesem neuen Impuls folgend, seinen Umlauf.
Dieses bei jeder Tour sich wiederholende Spiel erzeugt eine regelmäſsige Drehung, so
lange der Dampf hinzuströmt.
Man könnte nun den Einwurf erheben, daſs bei dieser Maschine, wo das Kolbenspiel
durch die abwechselnde Ausdehnung und Zusammenziehung einer biegsamen Röhre ersetzt
ist, das Innere der letzteren einen schädlichen Raum bilde, welcher den
Dampfverbrauch ohne entsprechende Nutzarbeit um ein Beträchtliches vermehre. Diesem
Einwurf zu begegnen, füllt der Erfinder die Röhre mit kurzen, an beiden Enden
geschlossenen Rohrstücken A' (Fig. 3) von entsprechendem
Querschnitt, welche lose, an einander gereiht, ein biegsames, den Formveränderungen
der Röhre A sich anschmiegendes System bilden. Es ist
somit kein schädlicher Raum vorhanden, und der Dampfverbrauch bleibt der durch den
Motor entwickelten Arbeit proportional.
Der Hohlkolbenschieber (Fig. 4) besteht aus einem
Bronzering c, welcher in einem zweiten an die
Ventilkammer b befestigten Bronzering c' gleitet. Der feste Ring besitzt zwei im Kreise über
einander angeordnete Löcherreihen, wovon die eine mit dem Dampfeinströmungsrohr b', die andere mit dem Ausströmungsrohr C in Verbindung steht. Angenommen der Schieber c befinde sich in seiner tiefsten Lage, wobei er die
untere Löcherreihe verdeckt, so strömt der Dampf aus der Röhre b' durch die obere Löcherreihe in die Ventilkammer und
von da in die elastische Stahlröhre, deren beide Schenkel er durch seinen Druck aus
einander treibt. In diesem Augenblick bewegt sich jedoch der Schieber aufwärts,
indem er die obere Löcherreihe verdeckt, zugleich aber die untere freiläſst, worauf
der in der elastischen Röhre enthaltene Dampf durch die Ventilkammer und die Röhre
C ins Freie oder in den Condensator strömt.
Soll comprimirte Luft als Kraftquelle dienen, so tritt die in Fig. 5 dargestellte
Ventilkammer an die Stelle der beschriebenen. Diese Ventilkammer besteht aus zwei
Abtheilungen M und M' in
deren jeder ein Hebel m und m' angeordnet ist. Der Hebelachse gegenüber ist jede dieser Abtheilungen
mit zahlreichen Löchern durchbohrt, welche die comprimirte Luft jedesmal
durchlassen, so oft der betreffende Hebel ein über die Löcher sich legendes, einerseits an das
Hebelende, andererseits an die Ventilkammer befestigtes Kautschukband n oder n' hinwegzieht. Das
eine Band n dient als Einlaſsventil, das andere n' als Auslaſsventil, und die Vertheilung der Luft
geschieht durch das abwechselnde Zu- und Aufdecken der Oeffnungen mit sehr geringem
Kraftaufwand, ohne daſs es nöthig wäre, die Berührungsflächen zu schmieren. Beide
Hebel m und m', deren
Achsen luftdicht aus den Kammern treten, erhalten ihre Bewegung von eisern auf der
Welle sitzenden Excenter durch Vermittlung der auf die Achsenenden festgekeilten,
durch eine Stange N an einander gekuppelten Hebel l und l'.
Der Erfinder macht zu Gunsten seiner Maschine mit elastischem Rohr, der gewöhnlichen
Dampfmaschine gegenüber, folgende Vortheile geltend: sie ist in ihrer Construction
einfacher, bedeutend leichter, gestattet, frei von Stöſsen oder Erschütterungen,
groſse Geschwindigkeiten ohne Räderwerk oder Riemenscheiben; der Arbeitsverlust in
Folge der Reibung des Kolbens und der Kolbenstange, die Dampfentweichung durch die
Stopfbüchse der letzteren, und ebenso das beständige Schmieren dieser Organe fällt
hinweg u s. w.
2) Tachymeter oder Tourenzähler (Fig. 6 und 7 Tafel 3). Die Function
dieses Instrumentes beruht auf der Aenderung des Rauminhaltes seiner elastischen
Röhre. Diese ist aus dünnem Messing hergestellt und mit einer Flüssigkeit gefüllt,
welche in der mit ihr communicirenden Glasröhre B
steigt oder sinkt, je nachdem der Rauminhalt der Röhre ab- oder zunimmt. Der kurze
kupferne Rohransatz a, welcher die Verbindung mit der
Glasröhre herstellt, tritt durch den Hals eines an den Holzsockel D befestigten eisernen Trägers C. Ueber diesem sind zu beiden Seiten der Glasröhre zwei von 0 bis 140
getheilte kupferne Scalen angebracht, auf denen die Tourenzahl der betreffenden
Maschine abgelesen werden kann. Die elastische Röhre ist an eine in der Hülse E laufende Verticalspindel befestigt, welche von der
Maschine, deren Rotationsgeschwindigkeit ermittelt werden soll, mittels der
Schnurscheibe G und zweier Winkelräder ihren Antrieb
erhält. Vermöge der Centrifugalkraft entfernen sich die an den Enden der Röhre A angebrachten Metallkugeln mehr oder weniger von
einander; dadurch ändert sich der innere Rauminhalt der Röhre A und somit das Flüssigkeitsniveau in der Glasröhre B. Auf der Scale, welche die den verschiedenen
Flüssigkeitshöhen entsprechenden Tourenzahlen anzeigt, läſst sich der bequemeren
Beobachtung wegen ein Zeiger auf- und niederschieben.
3) Manometer mit zwei communicirenden elastisch-biegsamen
Röhren (Fig. 8 bis 10 Taf. 3). Bei diesem
Manometer, welches Drucke von 300 bis 400at, wie
solche bei hydraulischen Pressen vorkommen, anzeigt, hat Bourdon beide Eigenschaften seiner Röhre, die Aenderung der
Krümmung und des Rauminhaltes verwerthet. Das Instrument besteht aus einer
Büchse von Glockenmetall, deren beide Theile B und B' an ihrem Umfange durch Bolzen und Muttern und in der
Mitte durch eine starke Schraube C hermetisch mit
einander verbunden sind. Um die Fläche, welche dem enormen Drucke des durch den
Kanal b' von der hydraulischen Presse kommenden Wassers
ausgesetzt ist, möglichst zu vermindern, ist der Raum a
zwischen Boden und Deckel der Büchse durch einen ringförmigen Vorsprung b der Rückwand vermindert. In diesen Raum ist eine
gekrümmte Stahlröhre A von elliptischem Querschnitt,
aus mehreren Metalldicken bestehend, eingeschlossen – letzteres, um dem von auſsen
einwirkenden hydraulischen Drucke den nöthigen Widerstand leisten zu können. Das
eine Ende dieser durch einen Metallpfropf geschlossenen Röhre ist frei, das andere
in ein Rohr D geschraubt, welches durch den Körper B' der Büchse tritt und an einen bronzenen Rohransatz
a' geschraubt ist, durch den die erste Röhre mit
der zweiten A' in Verbindung steht, wie aus der
Detailansicht Fig.
10 hervorgeht. Die Röhre A' ist aus Kupfer,
von der Wandstärke der gewöhnlichen Manometerröhren, und die Bewegungsübertragung
auf den Zeiger E erfolgt durch den nämlichen
Mechanismus, wie bei diesen. Die Röhre A zieht sich
unter dem von auſsen auf sie einwirkenden hydraulischen Druck zusammen, wodurch ihr
Rauminhalt eine Verminderung erleidet, und dehnt sich bei nachlassendem Drucke
wieder aus. Die Aenderung des Rauminhaltes aber hat eine Aenderung der Krümmung der
zweiten Röhre A' zur Folge, weil beide Röhren mit
einander verbunden und mit Wasser gefüllt sind. Alle Biegungen und momentanen
Formveränderungen der Röhre A theilen sich in
entgegengesetztem Sinne der Röhre A' mit, indem diese
sich ausdehnt, wenn die erstere sich zusammenzieht und umgekehrt.
4) Dampfdruckregulator (Fig. 11 und 12 Taf. 3).
Dieser Apparat besteht nach der Revue industrielle,
1877 S. 398 aus einer mit Rohransätzen O, M versehenen,
durch einen aufgeschraubten Deckel C verschlossenen
Büchse B, welche die gekrümmte Manometerröhre T umschlieſst; letztere wirkt auf ein Doppelventil S und wird durch ein auf dem Hebel C verstellbares Gegengewicht P äquilibrirt. Der Dampf strömt auf dem Wege nach dem Apparate, wo er
wirken soll, durch das Rohr M und das Ventil in die
Büchse. Nach Maſsgabe des zunehmenden Druckes zieht sich die Röhre T zusammen, schlieft das Ventil mehr und mehr, und
sperrt endlich, wenn die vorgeschriebene Druckgrenze erreicht ist, den Dampf
vollständig ab. Bei abnehmendem Drucke streckt sich die elastische Röhre, öffnet das
Ventil und läſst von neuem Dampf hinzu.
A.
P.
Tafeln