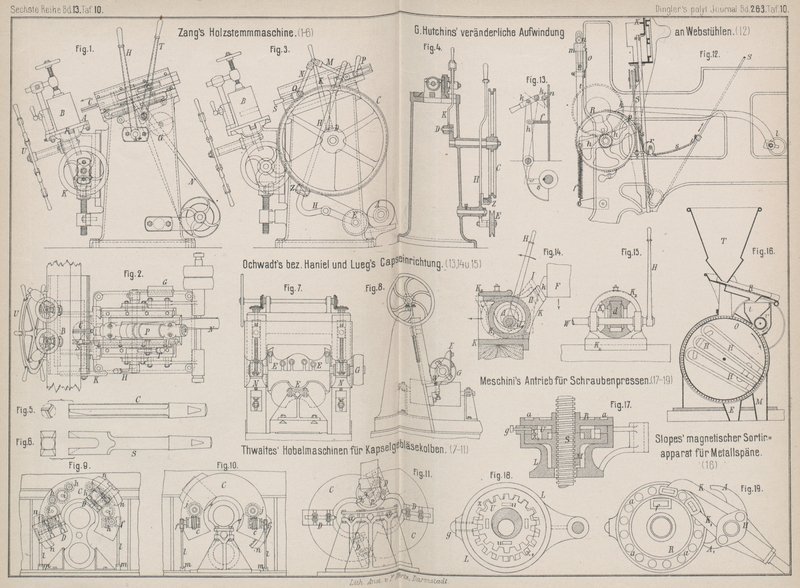| Titel: | Haniel und Lueg's bez. H. Ochwadt's sogen. Caps-Einrichtung. |
| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 172 |
| Download: | XML |
Haniel und Lueg's bez. H. Ochwadt's sogen.
Caps-Einrichtung.
(Patentklasse 5. Fortsetzung des Berichtes Bd. 260
S. 398.)
Mit Abbildungen auf Tafel
10.
Haniel und Lueg's bez. Ochwadt's sogen.
Caps-Einrichtung.
Die in Fig. 14
und 15 Taf.
10 veranschaulichte Aufsatz Vorrichtung von Haniel und
Lueg in Düsseldorf-Grafenberg (* D. R. P. Nr. 36469 vom 27. Februar 1886)
gehört derjenigen Gruppe dieser Apparate an, welche eine sofortige Abwärtsbewegung
der Förderschale von der Hängebank ohne vorheriges Abheben von den Stützen gestatten
und dadurch nicht nur die Zeit eines Aufzuges abkürzen, sondern auch die Seile
wesentlich schonen.
Die sogen. Hängestützen K sind mit dem Gleitstücke K1 zusammengegossen;
letzteres kann in der Büchse K2 hin und her gleiten. Die Feststellung, Vorwärts-
und Rückwärtsbewegung der Stützen K erfolgt mittels des
Handhebels H und der kreisförmig abgerundeten Daumen
d und d1, welche sich in einer Bohrung des Gleitstückes K1 bewegen. Handhebel
und Daumen sitzen auf einer Achse W, welche in der
Büchse K2. jedoch
auſserhalb des Mittels der Bohrung für die Daumen gelagert ist. In der Stellung Fig. 14 ruht
die Förderschale F mit den unten abgeschrägten
Aufsatztheilen k auf den mit gleich schrägen
Stützflächen versehenen Capskeilen oder Hängestützen K.
Soll die Förderschale abwärts gehen, so wird der Hebel H in der Pfeilrichtung umgelegt und durch die gleichzeitig erfolgende
Drehung der Daumen d und d1 schiebt sich das Gleitstück K1 in die Büchse E2 hinein. Die
Aufsatztheile k und die Stützen K gleiten an einander ab und, wenn sich die letzteren bis in die punktirt
angegebene Stellung I bewegt haben, wird die Schale
frei. Darauf werden die Stützen durch Zurückbewegung des Hebels H wieder in die Anfangsstellung zurückgebracht.
Wenn dann die Förderschale sich bei der Aufwärtsbewegung der Hängebank nähert, werden
die Stützen K durch die oberen entsprechend
abgeschrägten Flächen der Schalenansätze k in die
ebenfalls punktirt angegebene Stellung II gedreht; es
bilden hierbei die kreisförmig abgerundeten Daumen d
und d1 die Lagerflächen
für die Gleitstücke K1,
welche sich demgemäſs excentrisch zur Achse W drehen.
Nachdem die Förderschale durch die Aufsatzvorrichtung gegangen ist, fallen die
Stützen K durch ihr Eigengewicht in die Anfangsstellung
zurück und die Schale kann sich aufsetzen.
Die von H. Ochwadt in Grube Von der Heydt bei
Saarbrücken (vgl. * D. R. P. Nr. 20008 vom 29. Januar 1882) angegebene sogen.
Schachtfalle, welche in Verbindung mit einer Flüssigkeitsbremse arbeitet, soll sich
nach der Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und
Salinenwesen, 1886 Bd. 34 * S. 257 bei verschiedenen Ausführungen bewährt
haben. Neuerdings hat diese Aufsatzvorrichtung durch die im Zusatzpatente Nr. 29482
vom 21. Mai 1884 mitgetheilte Anbringung eines Kniehebelwerkes zum Festhalten der Hängestützen eine wesentliche Verbesserung erfahren. Das
Bogenstück s (Fig. 13 Taf. 10), welches
auf der Achse der Hängestützen befestigt ist, stemmt sich bei aufsitzender
Förderschale gegen den Hebel h. Damit dieser nicht
abspringt, ist derselbe oben durch den Kniehebel kk1 gehalten, welcher durch das einseitige
Uebergewicht des als Handhebel dienenden ersten Kniestückes k stets nach oben durchgedrückt ist und sich mit einer Nase n am zweiten Kniestücke k1 so gegen einen festen Punkt stemmt,
daſs eine gewisse Mittellage nicht überschritten werden kann. Soll abwärts gefördert
werden, so braucht der Anschläger nur das erste Kniestück k am Handgriffe aufzuheben. Sobald das Knie gestreckt ist, bringt das
Korbgewicht den Hebel h zum Abspringen. Während des
Korbdurchganges bleibt der Hebel h in Folge der
Bogenform des Stückes s in der Ausrücklage und wird,
sobald die Hängestützen sich durch die Wirkung von Gegengewichten in Verbindung mit
der Flüssigkeitsbremse wieder gehoben haben, durch die Feder f in die Anfangsstellung zurückgetrieben. – Durch diese Vorrichtung wird
erreicht, daſs der Hebel h niemals durch den Stoſs des
aufsetzenden Förderkorbes abspringen kann und daſs das Ausrücken selbst bei den
schwersten Körben nur eine verschwindend kleine Kraft erfordert.
Tafeln