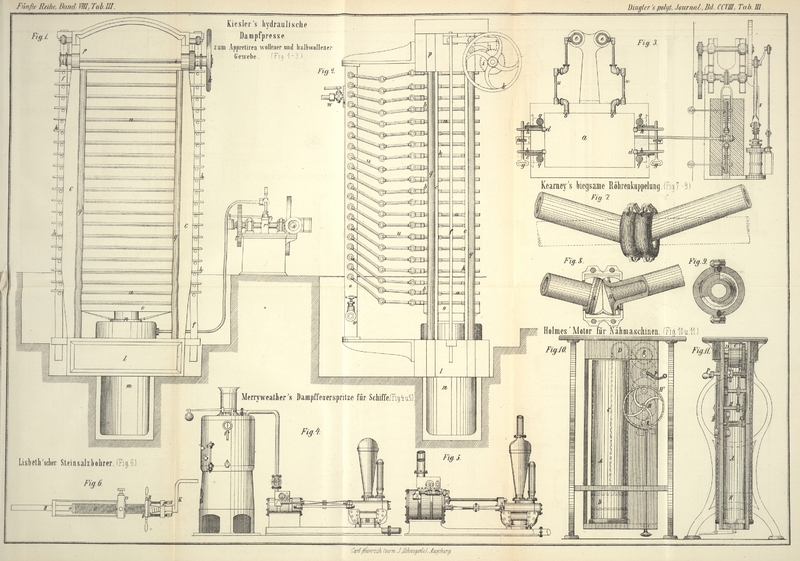| Titel: | Die Kiesler'sche hydraulische Dampfpresse zur Appretur wollener und halbwollener Gewebe. |
| Autor: | H. Bock |
| Fundstelle: | Band 208, Jahrgang 1873, Nr. XXXI., S. 105 |
| Download: | XML |
XXXI.
Die Kiesler'sche hydraulische
Dampfpresse zur Appretur wollener und halbwollener Gewebe.
Mit Abbildungen auf Tab. III.
Kiesler'sche hydraulische Dampfpresse zur Appretur wollener und halbwollener Gewebe.
Bei dem kolossalen Aufschwunge welchen vorzüglich in den letzten Jahren die Wollen- und Halbwollen-Industrie genommen
hat, wurde der Appreteur durch die Massenfabrication dieser Webwaaren gezwungen, die Handarbeiten mehr und mehr durch Maschinen
ausführen zu lassen, um eine raschere und bedeutend gleichmäßigere Production zu erzielen. Auch das Pressen der Wollen- und
Halbwollengewebe und die dazu verwendeten Apparate haben in Folge dessen bedeutende Verbesserungen erfahren.
Das Pressen dieser Waaren bildet die letzte Procedur welche sie durchzumachen haben, bevor sie in den Handel gelangen. Dasselbe
hat zum
Zweck, den Geweben einen bedeutenden Glanz oder Lüster, und somit ein schönes, dem Auge wohlgefälliges Ansehen zu verleihen.
–
Durchgängig wird zu diesem Behuf eine heiße Platte auf dem Tische einer Presse angebracht, auf diese Platte eine Partie Waare,
mit
dazwischen gelegten Preßspänen, geschichtet, letztere wieder mit einer
heißen Preßplatte gedeckt, auf welche abermals eine Schicht Waare folgt, und so fort, bis die Presse eingefüllt ist.
Die Platten müssen stets erhitzt werden, wenn der oben erwähnte Glanz durch das Pressen auf dem Gewebe erzeugt werden soll.
Dieß
geschah bis vor nicht langer Zeit auf folgende Weise: Man brachte die, meist aus Gußeisen oder Schmiedeeisen bestehenden Platten
in
einen sogenannten Preßofen, d.h. einen gußeisernen Kasten, in welchem die Platten reihenweise neben einander eingesetzt wurden,
worauf
derselbe durch einen Deckel dampfdicht verschlossen wird. Nun wird Dampf von 2 bis 4 Atmosphären Ueberdruck in den Kasten,
welcher zu
diesem Zwecke mit einem Dampfeinlaßventil versehen ist, gelassen, und auf diese Weise werden die Platten erhitzt. Nachdem
dieselben
gehörig durchwärmt sind und ungefähr eine Hitze von 96 bis 100° Réaumur angenommen haben, wird der Kasten geöffnet, und
die Platten werden herausgenommen, um mit der Waare in der oben angedeuteten Weise in die Presse eingeschichtet zu werden.
Daß diese Manipulation eine mehr oder weniger schwierige, und zugleich sehr zeitraubende Arbeit ist, leuchtet auf den ersten
Blick ein,
und dabei läßt diese Art des Pressens bezüglich der Gleichmäßigkeit noch viel zu wünschen übrig. Es ist daher erklärlich,
daß man
darauf sann, diesem Uebel abzuhelfen, und daß die hydraulische Dampfpresse mit hohlen Platten, welche durch
directe Dampfrohrleitungen von innen geheizt werden, in der letzten Zeit, wenigstens in den größeren Appreturanstalten, mehr
und mehr
Eingang fanden.
Die Figuren 1, 2 und 3 stellen die, mit bedeutenden Verbesserungen construirte Kiesler'sche Presse dieses Systemes,
nebst dem dazugehörigen Pumpwerk mit directem Dampfbetrieb, in der Vorderansicht, Seitenansicht und im Grundriß dar.
Die Presse enthält 21 schmiedeeiserne hohle Platten a, welche aus guten starken Blechen zusammengeschweißt sind, und zwar sind dieselben mit vielen schlangenförmig gewundenen Canälen versehen,
durch welche der Dampf streicht und die Platten auf diese Weise sehr gleichmäßig erhitzt; andererseits ist dadurch dem Durchbiegen
der
Platten eine Grenze gesetzt. An der hinteren Seite der Platte sind zwei Augen b, b angeschweißt, in welche
die Dampfzuleitungsrohre einmünden. An beiden Seiten der Platte befinden sich ebenfalls je zwei Putzen d,
d, welche sich dicht an die gußeisernen Führungsschienen c, c; anlegen, und dadurch die Platten
verhindern sich während dem Pressen nach vorwärts oder rückwärts zu verschieben. Diese Schienen c, c haben
von oben nach unten gehende und an Länge zunehmende Nuthen, welche den
untersten Stand der Platten durch Querstäbe, auf denen die Stifte h, h ruhen, begrenzen, somit einem
Kippen der Platten im Zustande der Ruhe vorbeugen, dadurch jedoch eine beliebige Verstellung derselben nach oben in keiner
Weise
verhindern, vielmehr den Platten gestatten, sich bis über das Doppelte der hier gezeichneten tiefsten Stellung einander zu
nähern.
Die Zuleitung des Dampfes geschieht durch gegliederte schmiedeeiserne Röhren u, welche mit ihren einen
Enden in die Augen b, b der Platten verschraubt, andererseits aber in den gußeisernen Röhren e, e, den sogenannten Standrohren, drehbar gedichtet sind. Die Röhren bestehen aus mehreren. Gliedern,
welche an ihren Enden durch eigenthümliche, solid construirte Stopfbüchsen dampfdicht in einander eingelenkt sind. Dadurch
ist den
Platten gestattet sich beliebig nach oben oder unten zu bewegen, ohne eine Verschiebung nach vor- oder rückwärts nothwendig
zu
machen, indem sich dann der kleiner oder größer werdende Abstand der Rohrenden durch Zusammenschieben resp. Auseinanderziehen
der
Rohrglieder selbstthätig regulirt, ohne jedoch die Dichtung in den Gelenken zu beeinträchtigen.
Vielseitig wendet man statt dieser Gelenkrohre zur Zuleitung des Dampfes aus den Standrohren in die Platten Gummischläuche
an, welche
zwar in der Anlage bedeutend billiger sind als jene, sich aber auf die Dauer in keiner Weise bewähren; gerade sie bilden oft
die
Veranlassung, daß einzelne Appreteure Anstand nehmen, die alte umständliche Presserei durch die neuere zu ersetzen, indem
sie sich
eine Dampfpresse anschaffen.
Das in den Platten sich condensirende Wasser fließt durch die Gelenkrohre in die Standrohre, von wo es durch einen selbstthätigen
Condensationswasserableiter ohne Dampfverlust abgeführt wird. Gleichzeitig dienen die Gelenkrohre zur Abführung der Luft aus
den
Platten beim Eintritt des Dampfes.
Um ein bequemes Einbringen der Waare zwischen die Platten zu bewerkstelligen, sind beiderseits der Presse zwei schmiedeeiserne
Schienen
f, f angebracht, durch die man in den Stand gesetzt ist jede einzelne Platte für sich zu heben, um den
Zwischenraum zwischen ihr und der nächst unteren zu vergrößern und so ein bequemes Einlegen der Waaren zu gestatten. Die Schienen
haben dazu mit den Platten correspondirende Löcher, in welche schmiedeeiserne, mit Handgriffen versehene Stifte g, g gesteckt werden können, auf denen alsdann die in die Platten eingeschraubten eisernen Handgriffe h, h ruhen. Wird nun die am Preßhelm gelagerte horizontale Winde i durch das Handrad k gedreht, so werden die Schienen f durch das damit verbundene Hebelwerk gehoben, und mit diesem die Platten um deren Hebung es sich
handelt. Einem freiwilligen Zurückgehen des ganzen Mechanismus ist durch eine Sperrvorrichtung Einhalt gethan.
Nachdem die Zwischenräume der Platten durch Waarenstöße gefüllt sind, beginnt der Preßproceß, und es liegt nun ganz in der
Hand des
Pressers, wie stark er die Platten heizen will, indem er den Dampfzufluß darnach regulirt.
Ist die Waare gleichmäßig durchhitzt und es macht sich ein schnelles Abkühlen der Platten nothwendig, so schließt er das
Dampfeinlaßventil v, öffnet dafür den am anderen Standrohr befindlichen Wasserhahn w, der mit einer Kaltwasserleitung oder einem Kaltwasserreservoir in Verbindung steht, und läßt somit kaltes Wasser durch
die Platten, wodurch dieselben schnell und gleichmäßig abgekühlt werden. Nach Absperrung des Wasserhahnes fließt das in der
Presse
zurückbleibende Wasser durch den Condensationswasserableiter selbstthätig ab. Die Presse wird nun zurückgelassen, und die
Waaren
werden ausgespänt, um das gleiche Manöver mit anderen zu pressenden Waaren zu beginnen.
Weitere Haupttheile der Presse sind, wie bei anderen hydraulischen Pressen, der in einem soliden Fundamentblock I gelagerte, auf einen zulässigen Totaldruck von 150000 Kilogrammen berechnete Preßcylinder m,
mit entsprechendem Kolben n und dem Preßtisch o. Der ebenfalls sehr stark
construirte Preßhelm p ist durch vier schmiedeeiserne Säulen q, q getragen und
gehalten.
Betrieben wird die Kiesler'sche Presse durch einen eisernen Pumpkasten mit zwei Preßpumpen r und r', mittelst einer kleinen direct wirkenden Dampfmaschine s, welche die Kraft durch ein am Pumpkasten gleichzeitig angebrachtes Rädervorgelege t, t' überträgt.
Durch diese gedrungene Anordnung wird außer einem dem Auge des Beschauers wohlgefälligen Ansehen, zugleich die bequemste Handhabung
des
Pumpwerkes und solideste Fundirung bezweckt.
Die Preßpumpen sind so eingerichtet, daß die eine, etwas größere, bei einem gewissen Druck selbstthätig ausgerückt werden
kann, während
die zweite, kleinere, fortarbeitet bis der höchstzugebende Druck erreicht ist, worauf auch sie selbstthätig ausgerückt wird.
Durch
diese Einrichtung wird jedem übermäßigen Beanspruchen der Presse, und somit auch jedem Springen eines Theiles der Presse oder
Pumpe
vollständig vorgebeugt.
Die beschriebene Presse übertrifft somit in ihrer Anordnung und Construction die meisten anderen Systeme; sie ist deßhalb
als
vollständig leistungsfähig, wo nicht als die leistungsfähigste ihrer Art zu betrachten.
Was die Ausführung derselben betrifft, so sey hier nur erwähnt, daß sie von der Zittauer Maschinenfabrik
(früher: Albert Kiesler und Comp.) in Zittau in die
bedeutendsten Appreturen Sachsens, Schlesiens, Westphalens und Oesterreichs, und zwar zur größten Zufriedenheit der Abnehmer
geliefert
wurde. Obige Firma hat bereits einen großen Ruf, vorzüglich in der Appretur-, Färberei – und Bleichereibranche erreicht
und ist fortwährend bestrebt diesen Ruf zu wahren. Durch die neuerdings erfolgte Umwandlung in ein Actienunternehmen sind
ihr die
Mittel geboten, ihre Einrichtungen in jeder Weise zu erweitern, so daß sie im Stande ist allen gestellten Anforderungen zu
genügen;
sie sey daher allen Appreturen, Färbereien und Bleichereien bestens empfohlen.
H. Bock.
Tafeln