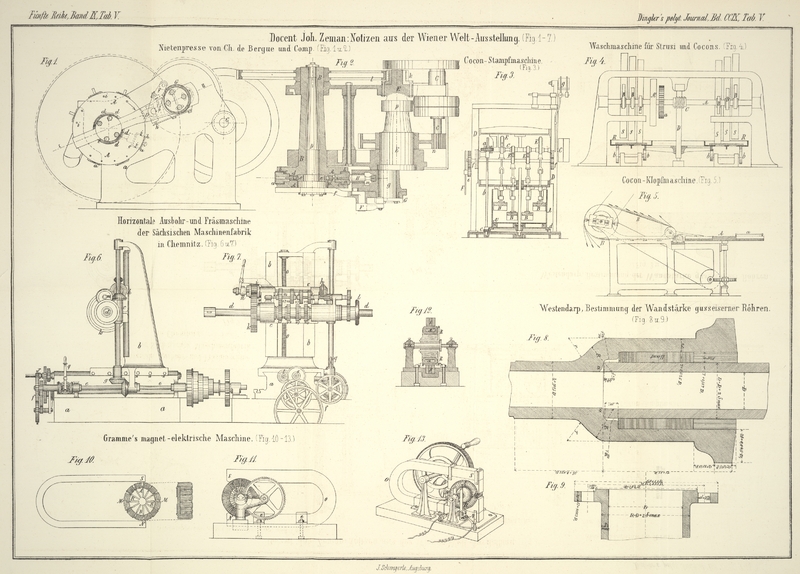| Titel: | Chambrier's Typendrucktelegraph. |
| Fundstelle: | Band 208, Jahrgang 1873, Nr. XLIII., S. 161 |
| Download: | XML |
XLIII.
Chambrier's
Typendrucktelegraph.
Aus dem Bulletin de la
Société d'Encouragement, Januar 1873, S. 3.
Mit Abbildungen auf Tab. V.
Chambrier's Typendrucktelegraph.
Der von Hrn. Chambrier, Telegraphen-Controlleur zu Charleville (Ardennen), construirte Apparat kann
als Zeigertelegraph oder als Drucktelegraph arbeiten. Das eigentlich Originelle liegt in dem Manipulator,
welcher die Bewegung eines Uhrwerkes mit der Bewegung einer von diesem unabhängigen Kurbel vereinigt. Jedesmal wenn die Kurbel
des
Manipulators in den, einem Buchstaben des Alphabetes entsprechenden Einschnitt hinabgedrückt wird, bewirkt dieser Druck die
Auslösung
des Uhrwerkes. Sofort beginnt ein mit der Kurbel concentrischer Zeiger unter den Augen des Telegraphirenden seinen Lauf, indem
er den
Buchstaben, auf welchem er zuletzt stand, verläßt und an dem neuen Buchstaben still steht. An der Zeigerachse sitzt das Rad
mit
wellenförmigem Profil, welches die Bestimmung hat, wie bei allen Zeigertelegraphen, den als Stromunterbrecher fungirenden
Hebel in
Thätigkeit zu setzen. Die Stromunterbrechungen, welche die ruckweise Zeigerbewegung des signalempfangenden Apparates veranlassen,
werden durch einen automatischen Mechanismus hervorgebracht, dessen im voraus regulirte Geschwindigkeit nicht durch die Hand
des
Telegraphisten beeinflußt wird. Außerdem ist dieser Mechanismus von der Richtung unabhängig, in welcher die Drehung der Kurbel
bis an
den zu signalisirenden Buchstaben erfolgt. Man kann daher den letzteren auf dem kürzesten Weg erreichen, und einen und denselben
Buchstaben wiederholen, ohne mit der Kurbel eine ganze Umdrehung zu machen. Dieser Zweck wird durch eine einfache und elegante
Vorrichtung erreicht. Das wichtigste Organ derselben ist ein auf der gemeinschaftlichen Achse des Zeigers und der Kurbel centrirtes
Rad, dessen Umfang mit einer der Zahl der Buchstaben und sonstigen Zeichen
entsprechenden Anzahl von Zähnen ausgestattet ist. Diese Zähne haben schräge Flächen, wie die Schaufeln einer Turbine, auf
welche das
Wasser von oben wirkt, und die Anordnung ist so getroffen, daß das Rad sich nur um einen sehr kleinen Winkel dreht, wenn man
dasselbe
aus seiner stabilen Lage bringt, in welche es durch eine Feder immer wieder zurückgeführt wird. Das Rad ist unter dem Zifferblatte
des
Manipulators angebracht, in welches man einen, jenen schrägen Zähnen entsprechenden Kreis von Löchern gebohrt hat. So oft
nun die
Kurbel in einen der Einschnitte gedrückt wird, dringt ein Stift, womit sie ausgestattet ist, durch eines der Löcher und kommt
auf
einen der schrägen Zähne zu liegen. Der Druck des Stiftes auf die geneigte Ebene dieses Zahns bewirkt eine kleine Drehung
des Rades,
in deren Folge der Ausrückhebel des Uhrwerkes verschoben und der Zeiger in Freiheit gesetzt wird. Um der Bewegung des letzteren
eine
Grenze zu setzen, ist an der nämlichen Achse unterhalb des Zifferblattes ein zweiter Zeiger parallel dem ersteren befestigt.
Dieser
Zeiger wird bei seiner Drehung durch den Stift der Kurbel, gegen den er stößt, genau unterhalb der Stelle des Buchstabens
auf welchen
er hinweisen soll, aufgehalten. Sobald der Telegraphist die Kurbel wieder hebt, steht das Uhrwerk von Neuem still, um nicht
eher
ausgelöst zu werden, als in dem Momente wo die Kurbel abermals niedergedrückt wird. Der Druck auf einen besonderen Knopf führt
den
Zeiger wieder auf das Kreuz (den Anfangspunkt) zurück, und gestattet den Uebergang vom letzten Buchstaben eines Wortes unmittelbar
auf
den ersten des folgenden Wortes. Des nämlichen Knopfes bedient man sich, wenn man von den Buchstaben auf conventionelle Zeichen
oder
auf Ziffern übergeht.
Der signalempfangende Apparat (le recepteur) ist mit einem Typenrad von kleinem Durchmesser ausgestattet.
Dieses Rad wird durch ein Uhrwerk in Bewegung gesetzt, dessen Auslösung auf gewöhnliche Weise mit Hülfe eines durch den Manipulator
periodisch in Thätigkeit gesetzten Elektromagnetes bewerkstelligt wird. Den Abdruck bewirkt ein nutzer dem Einflusse einer
Localbatterie stehender zweiter Elektromagnet, welcher das Papierband mit dem Typenrad in Berührung hebt. Diese Hebung erfolgt
nicht
durch Druck, sondern durch Stoß. Das Tupfbällchen, welches die Bestimmung hat, das Papier gegen das auf gewöhnliche Weise
geschwärzte
Typenrad anzudrücken, ist nämlich in verticaler Richtung beweglich, das untere Ende seiner Stange, welche in einer Führung
gleitet,
empfängt den Schlag eines mit dem Elektromagnet verbundenen Hammers mit etwas biegsamem Stiel. Das Papierband wird also gegen
das
Typenrad geschnellt und fällt augenblicklich wieder ein wenig zurück, so
daß es behufs des Abdruckes des folgenden Buchstabens sich fortbewegen kann, ohne dabei das Typenrad zu berühren.
Der Druckelektromagnet wird durch eine horizontal schwingende Feder in Thätigkeit gesetzt. Diese ist mit einer stählernen
Klinke
versehen, welche in die Zähne eines Sperrrades fällt. So lange sich dieses Rad mit rascher Geschwindigkeit dreht, verhindert
es durch
seine wiederholten Erschütterungen das Herabsinken der Feder; der Strom geht daher nicht durch den Elektromagnet. Sobald dasselbe
aber
still steht, fällt die Klinke in einen der Einschnitte des Rades und die Feder schließt die Kette welche die Localbatterie
mit dem
Elektromagneten verbindet. Das Sperrrad ist an die Achse des Typenrades befestigt, dessen Bewegungen es genau folgt, und die
Anzahl
der Stöße die es der Feder ertheilt, ist gleich der Zahl der von dem Manipulator entsendeten Ströme. Da diese Stromsendungen
rasch und
regelmäßig erfolgen, so kann man die Feder dergestalt reguliren, daß sie, so lange das Typenrad sich dreht, d.h. so lange
der Zeiger
des Manipulators sich selbst dreht, unthätig bleibt. Sobald aber das Typenrad still steht, d.h. sobald die Kurbel des Manipulators
in
Ruhe kommt, gehorcht die Feder ihrer Elasticität und Schwere, und stellt den Strom in Elektromagneten, von welchem der Druck
der
betreffenden Letter abhängt, wieder her.
Fig. 13 stellt den signalempfangenden Apparat und die Relais
des Läutewerkes, im Aufrisse, Fig. 14 den Manipulator im
Verticaldurchschnitte dar. Fig. 15 ist ein
Horizontaldurchschnitt des letzteren nach der Linie I–II der Fig. 14; Fig. 16 ist ein Verticaldurchschnitt, Fig. 17 eine untere Ansicht der Manipulatorkurbel. Die Figuren 18 und 19 sind Ansichten einiger Details des Manipulators im Aufriß und Grundriß.
In sämmtlichen Figuren sind die nämlichen Organe durch gleiche Buchstaben bezeichnet.
Der Manipulator. – a, a (Fig. 13 und 14) ist der Manipulator mit Uhrwerk und Kurbel; b (Fig. 14 und 16) ist die Kurbel, welche nach der einen wie nach der anderen Richtung
gedreht werden kann. Eine unter ihr in der Nähe ihres Rotationscentrums angeordnete Doppelfeder äußert das stete Bestreben
sie zu
heben, so daß es eines gewissen Druckes bedarf, um sie in eine der Kerben zu legen. c ist der Kranz mit
den Einschnitten oder Kerben, in welche man die Kurbel bei jedem zu signalisirenden Buchstaben senkt. d
ist eine in der Ebene und in der Mitte des Zifferblattes angeordnete Scheibe; sie ist an die Kurbel b
befestigt und mit dieser nach beiden Richtungen um eine verticale Spindel e drehbar, deren Rotation von
derjenigen der Kurbel unabhängig ist. Die Spindel e trägt unten ein mit dem Uhrwerk in Verbindung stehendes Rad, weiter oben das Contactrad f
(Fig. 14, 18 und 19) mit wellenförmiger Peripherie, und oberhalb der Kurbel b einen Zeiger g. Das Rad f setzt einen Hebel in Bewegung, welcher zwischen den Spitzen
zweier Contactschrauben oscillirt, wovon die eine mit der Batterie und die andere mit dem signalempfangenden Apparat in Verbindung
steht. Unter der Scheibe d ist jenes Rad h mit den schrägen Zähnen angeordnet,
welches nur einer kleinen Winkelbewegung fähig ist, und durch eine kleine Feder jedesmal wieder in seine ursprüngliche Stellung
zurückgeführt wird. Die Zahl seiner Zähne ist, wie bereits erwähnt wurde, derjenigen der Buchstaben des Zifferblattes gleich.
Eine von
dem Rade h sich abwärts erstreckende zurückgebogene Stange i (Fig. 16) hat die Bestimmung, die Bewegung der Spindel e zu hemmen, indem sie sich gegen den Windfang des diese Achse beherrschenden Uhrwerkes legt. j (Fig. 16) bezeichnet einen
kleinen Stift und einen Keil, welche beide an die untere Seite der Kurbel b oberhalb der Peripherie der
Scheibe d befestigt sind. Letztere ist an dieser Stelle mit einem kreisrunden Schlitz versehen, welcher
diesen Stift und Keil hindurchtreten läßt, wenn man einen Druck auf die Kurbel ausübt. Der Keil dient dazu, dem Rade h die erwähnte kleine Verschiebung zu ertheilen, und der Stift hat den Zweck der Bewegung jenes Rades f mit wellenförmiger Peripherie und mithin auch derjenigen des Zeigers g ein
Ziel zu setzen. Parallel mit dem letzteren und in einer Ebene mit ihm ist ein zweiter horizontaler Zeiger
k (Fig. 18) an die Achse e befestigt. Diese beiden Zeiger vollführen die gleichen Bewegungen, und der untere k ist es, welcher der Bewegung ein Ziel setzt, sobald er dem an der Kurbel befestigten Stift begegnet. Der Vorgang ist kurz
gesagt folgender. Wenn man die Kurbel bei einem Buchstaben des Zifferblattes niederdrückt, so wirkt der kleine Keil j, indem er durch die Oeffnung der Scheibe d tritt, auf den correspondirenden
schrägen Zahn des Rades h, und theilt demselben die mehrfach erwähnte kleine Winkelbewegung mit. Das an
dieser Bewegung Theil nehmende Stäbchen i löst dadurch den Windfang des Uhrwerkes aus, worauf die Spindel
e mit dem Zeiger g in Bewegung kommt. Aber der parallel mit dem letzteren
sich bewegende untere Zeiger k stößt bald an den Stift j der Kurbel, welche
man immer noch niedergedrückt läßt, und hält daher direct unter dem nämlichen Buchstaben an, auf den man die Kurbel geführt
hatte; mit
ihm steht auch die Spindel e still. Läßt man darauf die Kurbel frei, so steigt der Stift j wieder in die Höhe und das Rad h kehrt unter dem Einflusse einer Feder in
seine ursprüngliche Lage zurück, während zugleich das Stäbchen i wieder in den Windfang des Uhrwerkes
hemmend eingreift.
Auf folgende Weise führt man den Zeiger mit einem einzigen Ruck auf das Kreuz des Zifferblattes zurück, ohne nöthig zu haben
von der
Kurbel des Manipulators Gebrauch zu machen. m,
Fig. 15, ist ein horizontaler um seine Mitte drehbarer Hebel,
dessen rechter Arm sich in einen genau unter dem Kreuz des Zifferblattes angeordneten Winkelhaken endigt und durch eine Feder
in seine
ursprüngliche Lage zurückgeführt wird; n ist ein kleiner an dem hakenförmigen Hebelende senkrecht
angebrachter Stift; o ist ein unterhalb der Kreuzstelle an das Rad h
befestigter schräger Zahn. Wenn man nun, ohne die Kurbel des Zifferblattes zu berühren, gegen den Knopf l
des Hebels m drückt, so wird diese Manipulation eine kleine Verschiebung des Rades h zur Folge haben. Dadurch wird das Uhrwerk ausgelöst und die beiden Zeiger g und k kommen in Bewegung, werden jedoch an der Kreuzstelle angehalten, weil der Zeiger k dem Stifte n begegnet, welcher die Rotation unterbricht. Zugleich ist aber auch das Rad h in seine ursprüngliche Lage zurückgekehrt, und das Uhrwerk findet sich von Neuem gehemmt. p in Fig. 14 ist das Federhaus des
aus einem System von sechs Rädern bestehenden Uhrwerkes; die Spindel des vierten Rades trägt das Contactrad f und die des sechsten den Windfang. q ist der Schlüssel zum Aufziehen des Uhrwerkes.
Der Druckapparat. – r, Fig. 13, ist das auf die Steigradachse eines Uhrwerkes festgekeilte
Typenrad; s die Schwärzwalze; t das Papierband auf welchem die Buchstaben
und sonstige Zeichen abgedruckt werden; u, u' sind die beiden Auf- und Abwickelungsspulen für das
Papierband; v, v' die Walzen welche das Papier herbeiziehen. Ein kleiner mit Kautschuk überzogener Ballen
w ist unterhalb des Papierbandes angeordnet, gegen das er jedesmal wenn ein Buchstabe gedruckt werden
soll, schlägt, um dasselbe mit dem Typenrade in Berührung zu bringen. Dieser Ballen erhält seine Impulse durch den um die
Achse x' oscillirenden Hebel, welcher unterhalb seines vorderen Endes mit einer kleinen Kugel als Gegengewicht
ausgestattet ist, während sein hinteres Ende eine Armatur trägt, die durch den Elektromagneten β
der Localbatterie angezogen wird. Der nämliche Hebel bestimmt auch die Bewegung der Zugwalzen v, v'; y ist
eine Gegenfeder, deren Spannung sich mit Hülfe einer Schraube reguliren läßt. Auf der Steigradachse ist außer dem Typenrad
jenes
kleine, einer raschen Rotation fähige Sperrrad festgekeilt, dessen Zähnezahl der Buchstabenzahl des Typenrades entspricht,
und dessen
Bestimmung bereits oben näher erläutert worden ist.
Tafeln